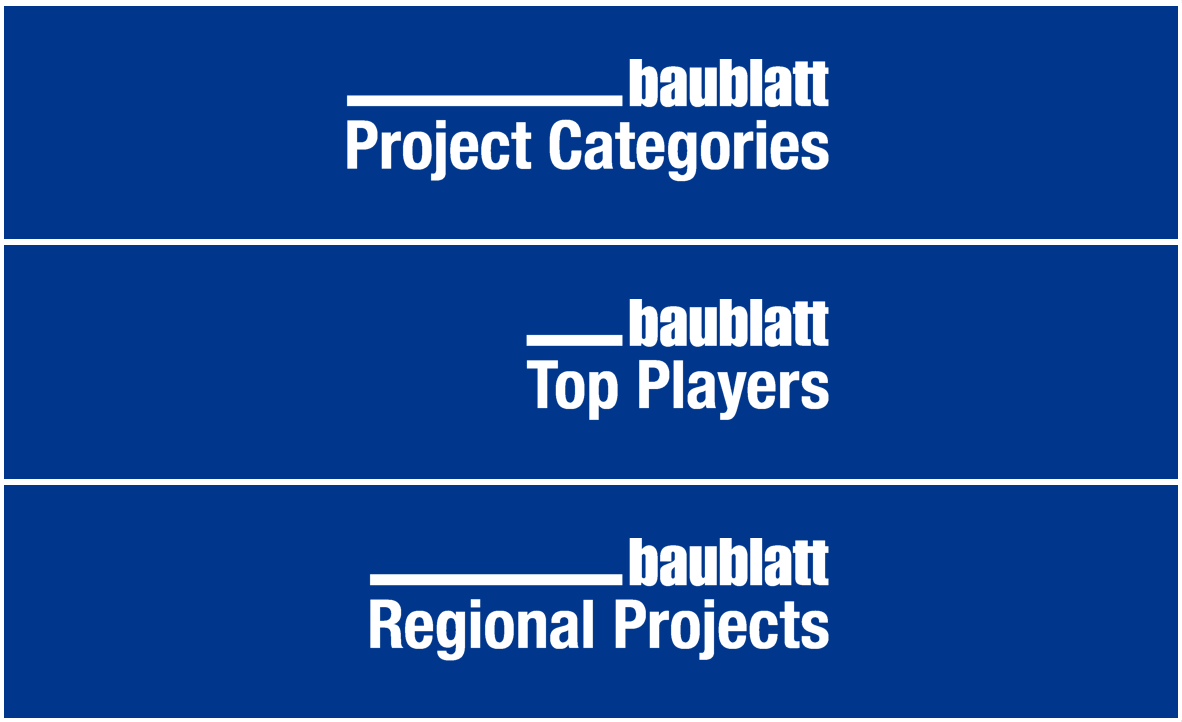Permafrost: Kein globales Klima-Kippelement aber trotzdem gravierende Folgen
Permafrostböden speichern viel CO2 und sie werden oft als kritisches Element beim Klimakipppunkt betrachtet. Laut der Studie eines internationalen Forschungsteams unter Leitung des deutschen Alfred Wegener Instituts (AWI) ist dies nicht ganz korrekt: Es gibt keinen bestimmten globalen Klimakipppunkt, sondern viele lokale und regionale Kippelemente. Diese «zünden» zu verschiedenen Zeiten, häufen sich und lassen schliesslich den Permafrost im Gleichschritt mit dem Klimawandel tauen.

Quelle: Contains modified Copernicus Sentinel data 2018
Durch auftauenden Permafrost entstandene Tümpel auf der Jamal-Halbinsel im Nordwesten Sibiriens, aufgenommen von der Copernicus-Sentinel-2-Mission der ESA am 27. August 2018.
Sie bedecken rund einen Viertel der Landfläche der Nordhalbkugel: Permafrostböden. Und sie speichern Unmengen organischen Kohlenstoffs in Form von abgestorbenen Pflanzenresten, die sich - solange sie gefroren sind - nicht abbauen. Erst wenn der Permafrost taut und damit Mikroorganismen aktiv werden, wird Kohlenstoff als CO2 und Methan in die Atmosphäre freigesetzt. Die weltweit steigenden Temperaturen könnten diese gigantischen Speicher somit aktivieren und den Klimawandel durch zusätzliche Emissionen verstärken. Aus diesem Grund wird immer wieder von der «tickenden Kohlenstoff-Zeitbombe» gesprochen.
Diese Annahme gründet auf der Idee, dass der Permafrost - ähnlich wie der Eisschild auf Grönland - eines von mehreren Kippelementen im Erdsystem bildet. Demnach schwindet der Permafrost im Zuge der globalen Klimaerwärmung zuerst nur langsam. Erst wenn einen kritischen Schwellenwert übersteigt, verstärken sich die Auftauprozesse selbst: Ein rasanter, unumkehrbarer globaler Permafrost-Kollaps setzt ein. Obwohl ein solches Auftauszenario häufig vermutet werde, habe bislang nicht geklärt werden können, ob ein solcher Schwellenwert wirklich existiere und bei welcher Temperatur dieser überschritten werden könnte, heisst es dazu in der Medienmitteilung des Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI).
Prozesse wirken lokal oder regional
Jan Nitzbon vom AWI ist dem Thema mit seinem Team auf den Grund gegangen. «Tatsächlich ist die Darstellung des Permafrosts als globales Kippelement in der Forschung umstritten», sagt der Wissenschaftler und ergänzt, dass auch der Weltklimarat IPCC in seinem letzten Sachstandsbericht darauf hingewiesen habe. «Wir wollten diese Wissenslücke schliessen. Dazu haben wir für unsere Studie die verfügbare wissenschaftliche Literatur zu den Prozessen zusammengetragen, die das Auftauen von Permafrost beeinflussen und beschleunigen können.» Unterlegt mit einer eigenen Datenanalyse habe man alle aktuellen Erkenntnisse zu Auftauprozessen daraufhin bewertet, ob und auf welcher räumlichen Skala – lokal, regional, global – sie zu einem selbsterhaltenden Auftauen und somit zum Kippen bei einem bestimmten Erwärmungsschwellenwert führen könnten.
Das Studienergebnis zeigt: Es gibt sich selbst verstärkende, teilweise unumkehrbare geologische, hydrologische und physikalische Prozesse, sie wirken allerdings nur lokal oder regional. Ein Beispiel ist die Bildung sogenannter Thermokarst-Seen: Dabei schmilzt Eis in Permafrostböden, die daraufhin absinken. Das Schmelzwasser sammelt sich an der Oberfläche und bildet einen dunklen See, der viel Sonnenergie absorbiert. Dadurch verstärkt sich die Erwärmung des Permafrosts unter dem See weiter und es entsteht ein sich selbst erhaltender Tauprozess in dem Gebiet um den See. Ähnliche verstärkende Rückkopplungen fanden sich auch bei anderen für den Permafrost relevanten Prozessen wie dem Verlust von borealen respektive nördlichen Nadelwäldern durch Brände – auch hier jedoch nur im lokalen bis regionalen Massstab. Laut Nitzbon gibt es keine Evidenz für sich selbst verstärkende interne Prozesse, die ab einem bestimmten Grad der globalen Erwärmung den gesamten Permafrost gleichzeitig erfassen und das Tauen global beschleunigen würden: «Auch die geschätzte Freisetzung von Treibhausgasen würde mindestens bis zum Ende des Jahrhunderts nicht zu einem globalen Sprung in der Erderwärmung führen. Deshalb ist die Darstellung des Permafrosts als globales Kippelement irreführend.»
Studie zeigt, wie heterogen die Permafrostzone ist
Dennoch: Eine Entwarnung für den Permafrost bedeutet dies nicht. Laut dem Team um Nitzbon bedeutet dies vielmehr das im Gegenteil. Die Studie mache deutlich, dass die Permafrostzone sehr heterogen sei, heisst es in der Medienmitteilung des AWI. Viele kleine lokale Kipppunkte werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und bei unterschiedlichen Erwärmungslevels überschritten und akkumulieren über die Zeit. Dadurch verlaufe das weltweite Tauen des Permafrosts nicht langsam ansteigend und dann mit einem plötzlichen Sprung, sondern im Gleichschritt mit der globalen Erwärmung ansteigend bis zum Totalverlust bei etwa 5 bis 6 Grad Celsius globaler Erderwärmung.
«Das bedeutet, dass schon heute und auch in naher Zukunft mehr und mehr Gebiete unausweichlich vom Auftauen betroffen sind», sagt Nitzbon. «Es gibt also – und so suggeriert es das Bild des Kipppunktes – keinen beruhigenden Erwärmungsspielraum, den man bis zum Schwellenwert noch ausreizen kann. Deshalb müssen wir die Permafrostgebiete mit noch besserem Monitoring im Auge behalten, die Prozesse noch besser verstehen und in Klimamodellen abbilden, um die Unsicherheiten noch weiter zu reduzieren.»
Und klar ist für den Forscher auch, dass je schneller die Menschheit bei einem an die Treibhausgas-Emissionen gekoppelten Permafrostverlust Netto-Null-Emissionen erreicht, umso mehr Gebiete «als einzigartiger Lebensraum und Kohlenstoffspeicher» erhalten bliebe. (mgt/mai)
Die originale Meldung auf www.awi.de lesen.