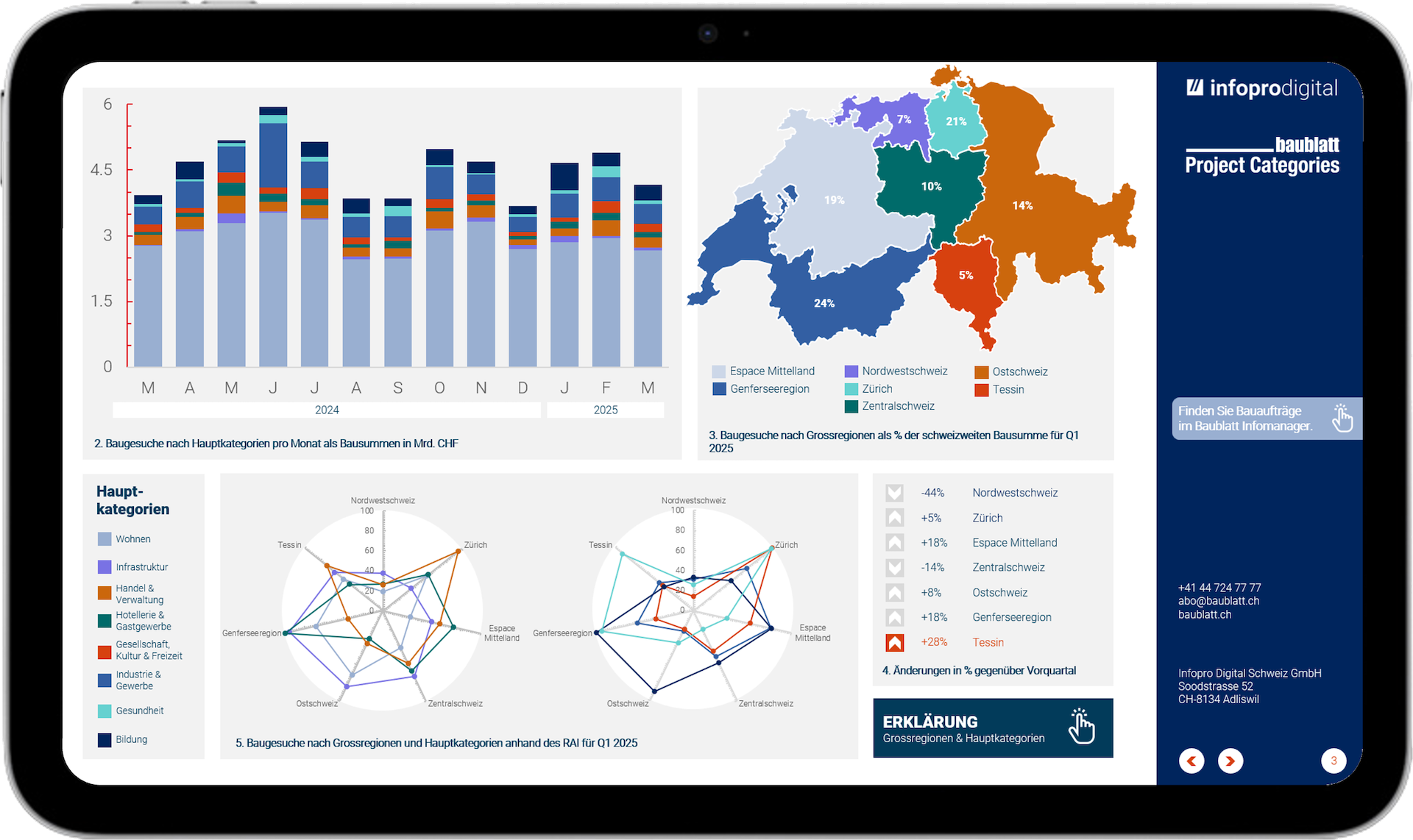Barrierefreies Bauen: Wege zu einer verbindenden Architektur
«Unsere Städte und Wohnungen sind so gebaut, dass wir uns abhängig fühlen», sagt die spanische Architektin Anna Puigjaner. Was in der Architektur als Norm gilt, bedeutet für viele Menschen Barrieren und Hindernisse. Über Wege zu einer Architektur, die nicht ausschliesst, sondern verbindet.

Quelle: Luis Urculo
Studierendenprojekt «Care Kiosk» von Anna Puigjaner: Sorgearbeit soll weniger privat und für alle öffentlich zugänglich sein.
«Architektur kann brutal sein», sagt Anna Puigjaner. Ständig unterteile sie die Menschen – in jene, die können, und in jene, die nicht können. Die spanische Architektin führt aus: «Nehmen wir eine Treppe als Beispiel. Allein dieses architektonische Element unterteilt die Gesellschaft in jene, die hinauf- oder hinuntersteigen können, und jene, die es nicht können.»
Das, was in der Architektur bisher als Norm gilt, ist nur für eine Minderheit ideal. Für viele Menschen stellen die baulichen Standards gar ein unüberwindbares Hindernis dar. «Architektur ist nicht neutral und hat Auswirkungen auf die Gesellschaft», sagt Puigjaner. «Und leider hat die Architektur in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Vorurteilen bestätigt und reproduziert.»
Wohnungsnorm für Minderheit
Dass sich die meisten Wohnungen nach wie vor nach der Kernfamilie ausrichten – mit einem Wohnzimmer als Treffpunkt für alle, einem bis zwei kleineren Schlafzimmern für Kinder und einem geräumigeren Zimmer für die Eltern, bestätigt zum Beispiel das Vorurteil, dass dies die vorherrschende Wohnkonstellation ist. «In der Schweiz, aber auch in meiner Heimat Spanien lebt nur rund ein Viertel der Menschen in einer Kernfamilie. Was passiert mit den anderen drei Vierteln, die nicht in diese Lebensform passen?», fragt Puigjaner. Alleinlebende, Freunde, die zusammenwohnen, kinderlose Paare, Grossfamilien, Patchwork-Familien, queere Familien, Alleinerziehende: Trotz vielfältigen Lebensformen gilt seit Jahrzehnten derselbe Wohnraum als Standard. «Das erzeugt eine Menge Vorurteile. Und festigt Machtstrukturen – auch innerhalb der Familie. Allein dadurch, dass die Eltern mehr Platz haben, scheinen sie wichtiger als die Kinder», sagt Puigjaner.
Architektur, die verbindet
Puigjaner setzt sich für eine Architektur ein, die nicht trennt. c. Eines ihrer Hauptthemen ist die alternde Gesellschaft und die damit verbundene Zunahme von Gesundheitsproblemen. «Pflege und Betreuung stecken weltweit in der Krise und brauchen neue Ansätze», sagt sie. Architektur trage wesentlich zu diesen Problemen bei.
Ihr Lehrstuhl untersucht, wie Pflege, Betreuung und alltägliche Tätigkeiten auf Individuen und die Gesellschaft wirken und wie Architektur Barrieren abbauen kann. Viele Tätigkeiten wie Kochen, Putzen oder Waschen sind immer noch privat organisiert, was auf dem Modell der Kernfamilie basiert. Diese Strukturen entsprechen aber oft nicht mehr der Realität: «Unsere gebaute Umwelt erzeugt ungleiche Abhängigkeiten, die neu definiert werden müssen», so Puigjaner.
Viele ältere Menschen können Alltagstätigkeiten nicht mehr allein bewältigen. «Wie können wir unsere Städte so gestalten, dass die Trennung zwischen abhängigen und unabhängigen Körpern aufgehoben wird?», fragt Puigjaner. Auch jüngere Menschen erleben im Laufe ihres Lebens Phasen von Abhängigkeit, sei es durch Krankheit oder familiäre Rollen.
Sorgearbeit öffentlich machen
Puigjaner fordert, Sorgearbeit aus dem Privaten ins Öffentliche zu holen. Alltagstätigkeiten sollten als Teil der städtischen Infrastruktur betrachtet werden, ähnlich wie Bibliotheken oder Stromversorgung. Dies könne soziale Bedürfnisse besser erfüllen und Barrieren abbauen. Infrastrukturen, die Alltagstätigkeiten erleichtern, könnten zudem das Gesundheitssystem entlasten. Ein Beispiel sind öffentliche Küchen. Solche Ansätze könnten zur Inklusion und zum Abbau von Barrieren beitragen.
In Singapur etwa sanken durch öffentliche Küchen die Ausgaben für ältere Menschen, da die Nutzenden sich gegenseitig unterstützen. Solche Ansätze fördern passive Gesundheitsfürsorge und könnten in die Siedlungsplanung integriert werden. Bogotá geht mit den «Manzanas del Cuidado» einen Schritt weiter: Diese Versorgungszentren bieten öffentliche Küchen, Kinderbetreuung und Wäscheservices, was die soziale Teilhabe stärkt.

Quelle: Aude Sahli
Studierende von Momoyo Kaijima untersuchen, wie Architektur Barrieren zwischen dörflichem und städtischem Leben abbauen kann.
Schule neu denken
ETH-Professorin Momoyo Kaijima plädiert für flexible Schularchitektur. Klassenzimmer sollten Lernende und Lehrende zusammenbringen, statt starre Strukturen zu fördern. Angesichts einer alternden Gesellschaft und sinkender Kinderzahlen sieht Kaijima darin eine Chance, Lernräume generationenübergreifend nutzbar zu machen.
Inklusion für alle
Die Schweizer Baugesetze berücksichtigen vor allem physische Barrierefreiheit, jedoch kaum die Bedürfnisse neurodivergenter Menschen. Puigjaner fordert visuell reizarme Räume mit klarer Orientierung und Rückzugsmöglichkeiten. Am Lehrstuhl «Architektur und Care» wurde mit Theater Hora ein inklusives Stadtmodell entworfen, das für alle nutzbar ist.
Die demografischen Veränderungen kommen schneller, als die Architektur reagieren kann. Beide Professorinnen betonen, dass bestehende Strukturen saniert und an die Bedürfnisse aller angepasst werden müssen. «Wir müssen schnell denken und handeln», fordert Puigjaner. (ETHZ / Corinne Landolt / kür)
*Corinne Landolt ist Mitarbeiterin bei News & Themen an der ETH Zürich. Der vollumfängliche Beitrag erschien zuvor in den ETH-News unter https://ethz.ch.