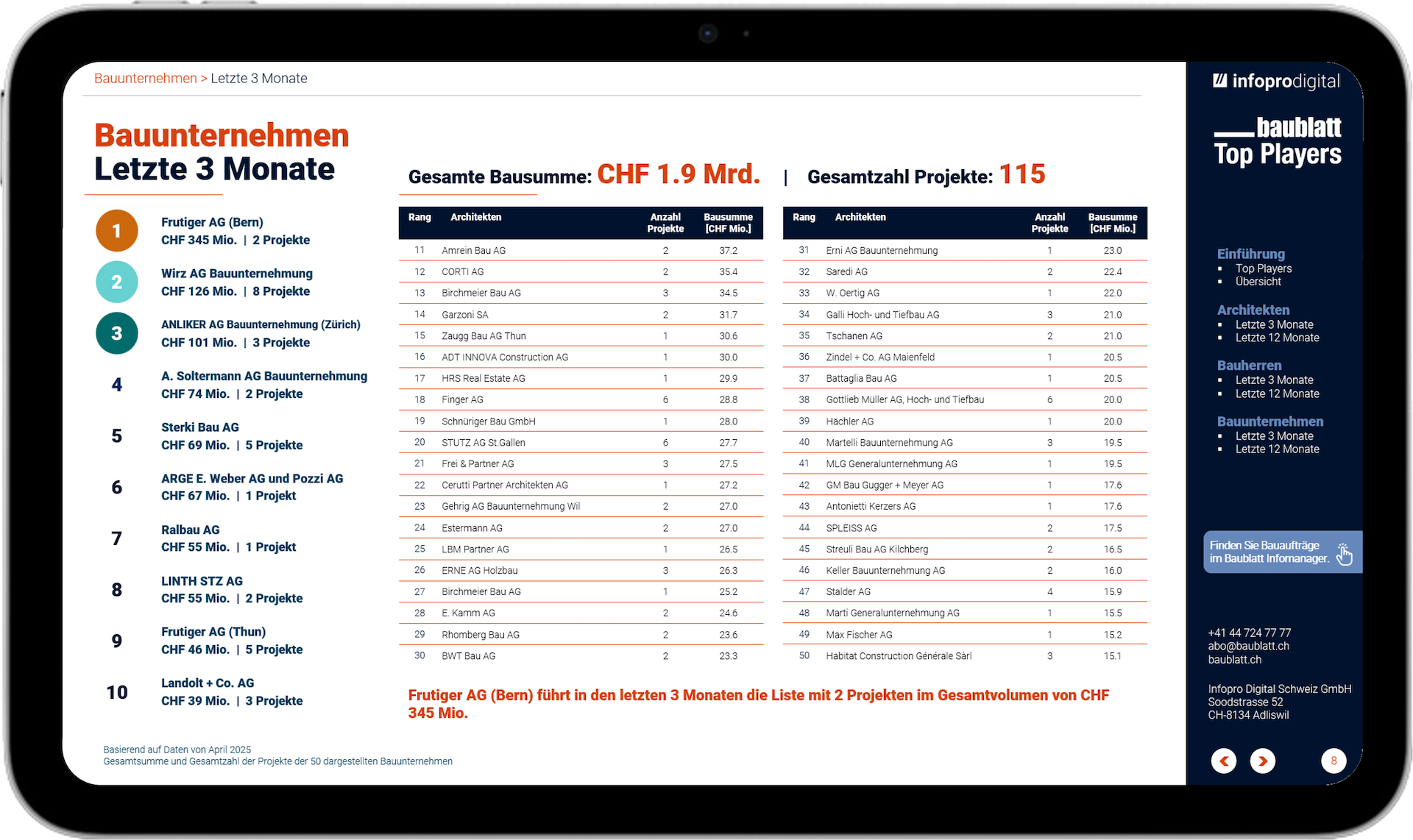Ausstellungstipp: Kreislaufwirtschaft ist nicht neu
Wer in Zürich unterwegs ist, kommt kaum an ihnen vorbei: Plakate, die dazu aufrufen, Gegenstände weiterzugeben oder, wenn möglich, zu reparieren, statt sie wegzuwerfen. Gleichzeitig läuft im Landesmuseum bis zum 10. November die Ausstellung «Das zweite Leben der Dinge – Kreislaufwirtschaft im Laufe der Zeit». Sie zeigt, wie man über Jahrtausende mit Abfällen umgegangen ist.

Quelle: Muntaka Chasant, eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
Verarbeitung von Elektroschrott im Stadtteil Agbogbloshie in der Millionenstadt Accra in Ghana: Junge Männer verbrennen elektrische Drähte, um daraus Kupfer zu gewinnen.
Die Botschaft, die sowohl die Ausstellung als auch die Plakate vermitteln wollen, ist klar: Vieles, was in unserer Konsumgesellschaft im Abfall landet, ist nur subjektiv nicht mehr brauchbar. Das Abfallvolumen wächst stetig. Und Roman Köster von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften – einer der beratenden Experten der Ausstellung – sieht in naher Zukunft keine wesentliche Reduktion des Müllaufkommens: «Das gab es nie und es sieht nicht so aus, als ob sich das ändern würde. Zero Waste ist ein reines Schlagwort.» Die Herausforderung besteht darin, unsere derzeitige lineare Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft zu transformieren: Eine Wirtschaftsform, in der Müll durch Wiederverwendung (Second-Hand), Weiterverwertung (Recycling) oder Reparaturen reduziert wird. Das Thema wird deshalb gerade an mehreren Stellen aufgegriffen, da es eines der grössten Probleme unserer Gesellschaft ist.
Die Schweiz ist heute zwar ein im wahrsten Sinne sauberes Land mit vorbildlicher Abfallwirtschaft. Doch beim Verbrauch von Ressourcen und der Abfallmenge pro Kopf gehört sie ebenfalls zu den Spitzenreitern. Die Tatsache, dass hiesige Städte so gepflegt wirken und auch die meisten europäische Metropolen einen ordentlichen Eindruck machen, ist eine relativ neue Errungenschaft. In ärmeren Ländern liegt dieser Zustand oft noch in weiter Ferne. Alle kennen die Bilder von vor sich hin schwelenden, erschreckend riesigen Mülldeponien. Die Ärmsten der Armen leben auf und von ihnen. Indem sie Dinge aussortieren und auseinandernehmen, stets auf der Jagd nach noch brauchbaren Materialien, die sich verkaufen lassen. Oft genug kommt der Abfall auf diesen Deponien aus Industrienationen und ihren Wegwerfgesellschaften, denen die Infrastruktur (noch) fehlt, selber damit klarzukommen. Köster, der kürzlich mit «Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit» ein informationsreiches Buch über den globalen Umgang der Menschen mit Abfall über die letzten Jahrhunderte geschrieben hat, sagt: «Im globalen Süden ist der Müll aktuell das drängendste Problem.»
Städte als Ursprung für Müllprobleme
Es ist nicht lange her, dass es bei uns nicht viel besser aussah, wie Kösters Werk aufzeigt: Müllsammler- und -sortierer gibt es, seit es Städte gibt, also seit der Mensch sesshaft wurde, mehrere Jahrtausende vor Christus. «Städte waren stets der Ursprung für Müllprobleme, die gelöst werden mussten.»
Köster beschreibt, wie in frühen Städten der Müll oft einfach vor der Tür aufgehäuft, in nahen Senkgruben verscharrt oder auf Deponien an den äusseren Rand der Stadt gebracht wurde. Der Kot der Menschen und der damals noch in den Städten lebenden Nutztiere war ein begehrtes Gut und wurde von Leuten aus der Unterschicht gesammelt. Er konnte als Dünger an die Bauern ausserhalb der Stadt verkauft werden. Lumpensammler gehörten ebenfalls zum Stadtbild, denn aus zerstampften Textilien liess sich Papier herstellen. Das Problem, mit dem die Müllbeauftragten zu kämpfen hatten: Mit jedem grösseren Bevölkerungszuwachs, jeder tiefgreifenden Veränderung und Entwicklungen der Lebensweise musste auch die Abfallinfrastruktur entsprechend angepasst werden.

Quelle: Paul Géniaux, Paul, CC0
Lumpensammler bei der Arbeit in Paris Ende des 19. respektive Anfang des 20. Jahrhunderts.
Und: Die Beseitigung des Mülls wurde mit der Zeit immer komplexer, manchmal sogar unlösbar. Mit der Industrialisierung kam eine neuer Akteur hinzu: Die Fabriken, deren Schadmüll unbedacht mit Haushaltsabfall entsorgt wurde. Laut Kösters Buch meldeten sich erstaunlich früh Bedenkenträger, die darauf aufmerksam machten, wie das Gift im Industriemüll bei einer Abfallwirtschaft, wie sie damals üblich war, einfach in die Umwelt gelangen konnte. Ebenfalls erstaunlich früh vernetzten sich Müllbeauftragte weltweit, tauschten ihr Wissen im Umgang mit dem Abfall aus.
Aus alten Priesterornaten wird ein neuer
Vor der Industrialisierung war niemand wohlhabend genug, funktionierende Dinge einfach auszumustern. Noch nicht einmal der Klerus oder die reiche Oberschicht. In der Ausstellung im Landesmuseum sieht man einen prächtigen Priesterornat, der offensichtlich aus Stoffen anderer Talare genäht worden war. Oder die Weste eines Mannes, deren sichtbarer Teil aus kostbarem, besticktem Stoff besteht, während für den Rückenteil, der unter dem Sakko verborgen bleibt, billiges Leinen genutzt wurde. Diese Textilien waren schlicht zu wertvoll, um sie wegzuwerfen. Also hat man sie wiederverwendet. Ein Musterbeispiel für die Kreislaufwirtschaft, zu der man laut Experten dringend zurückkehren muss. Wobei es ein «Zurück», laut Köster nicht geben wird: «Unser Müllproblem hat mit der Massenproduktion zu tun. Die Dinge kosten so wenig, davon kommen wir nicht mehr weg.» Sobald etwas teurer werde, reagiere die Bevölkerung extrem emotional – man denke an den Ölpreis. «Politiker scheuen sich, solche Themen anzupacken.»
Wiederverwendung durch Weitergabe an andere ist ein wichtiger Aspekt der Kreislaufwirtschaft. Flohmärkte und Second-Hand-Läden gibt es auch heute noch, doch deren Potenzial wird nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft. Ein weiteres Beispiel für frühe Kreislaufwirtschaft und eine Lösung des Müllproblems für die Zukunft: Reparaturen. Vor der Wegwerfgesellschaft gab es kaum einen Kessel oder eine Pfanne, die bei einem Defekt nicht geflickt wurde. Waren Metallgegenstände tatsächlich irreparabel, wurden sie eingeschmolzen und zu neuen Utensilien weiterverarbeitet.

Quelle: Schweizerisches Nationalmuseum
Dieser mittig auseinandergebrochene Keramikteller aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde mittels Metallklammern geflickt. Zunächst bohrte man Löcher, um die Klammern anzubringen. Danach konnten Löcher und Risse mit Kitt abgedichtet werden. Auf ähnlich Weise wurden Keramikgefässe schon in prähistorischer Zeit repariert.
Wer zu den älteren Semestern gehört, mag sich noch an Reparaturwerkstätten für die frühen Mobiltelefone und Computer oder Läden zum Auffüllen von Tintenpatronen erinnern. Viele konnten ihr Auto oder ihre Elektrogeräte selbst flicken, Löcher in Textilien ausbessern, sie neu färben oder anderswie aufpeppen. Dieses Wissen ist heute weitgehend verloren gegangen. Zum Teil, weil es einfacher und oft billiger ist, etwas neu zu kaufen - etwa Kleider, die wir sowieso schon im Übermass besitzen.
Ökonomische Obsoleszenz, Autos und Elektrogeräte
Bei Autos und Elektrogeräten liegt das Problem allerdings auch darin, dass sie inzwischen zu kompliziert konstruiert sind, um sie selbst wieder in Schuss zu bringen. Ihre Materialien sind so komplex verbunden, dass es sogar den versierten Sammlern auf den globalen Müllkippen schwerfällt, daraus wertvolles Material zu extrahieren. Und das, obwohl gerade in den Elektrogeräten seltene Erden verbaut sind, deren Vorkommen begrenzt ist. Umso wichtiger wäre es, sie aus den Produkten herauszunehmen und recyceln zu können. Ökonomische Obsoleszenz ist hier das Stichwort: Die Hersteller verkürzen den Lebenszyklus ihrer Produkte einerseits künstlich, machen aber auch unmöglich, sie zu reparieren oder weiter zu verwerten.
Recycling gilt als eines der Schlüsselwörter im Kampf gegen die Müllflut. Für Köster ist Recycling allerdings eher ein Herumdoktern an Symptomen einer Krankheit, die man an den Wurzeln anpacken sollte: «Die Müllmenge explodiert und wir kriegen sie nicht weg. Das war schon immer so - natürlich nicht in dem heutigen Ausmass.» In früheren Jahrhunderten zwangen Infektionskrankheiten wie Typhus und Cholera die Abfallbeauftragten zu einem hygienischeren Umgang mit dem Müll. Heute ist es der giftige Industriemüll, der berechtigte Angst vor Krebs schürt. Köster: «Wir vergiften uns quasi selbst.»
«In der Schweiz funktioniert das Recycling für einige Materialien recht gut», ergänzt Jasmin Mertens, Leiterin der Fach- und Koordinationsstelle Kreislaufwirtschaft bei der Baudirektion des Kantons Zürich, sie führte ebenfalls als Expertin Besucher durch die Ausstellung. «Bei Papier, PET und Glas haben wir sehr hohe Rücklaufquoten von über 80 Prozent. Bei Kunststoffen stehen wir noch am Anfang. Und das Recycling allein wird uns nicht retten. Momentan decken wir in der Schweiz bloss etwa 11 Prozent unseres Rohstoffs aus recycelten Materialien.» Mertens sieht nur eine Lösung: Die Werterhaltung muss schon bei der Produktion der Dinge mitgedacht werden. Man sollte Produkte so konzipieren, dass der Einzelne sie selbst reparieren kann. Oder wenn sie durch ein kaputtes Einzelteil unbrauchbar werden, die Möglichkeit etablieren, dieses auszutauschen. Ersatzteile aufzutreiben, ist heute oft praktisch unmöglich. Und sowieso: Wie bei den Kleidern ist auch die Reparatur eines Flat-Screen-TVs teurer, als ein neuer zu kaufen.
Neuer Denkansatz gefragt
Für die Expertin braucht es einen neuen Denkansatz. «Besonders im Baubereich, denn dort fallen zirka 60 Prozent unseres Abfalls an. Beim Bauen denkt man vielfach in kürzeren Zeiträumen als nötig. Gebäude aus den 1980er-Jahren werden, obwohl völlig funktionstüchtig, einfach abgerissen. Wir müssen Bauten entwickeln, die Hundert Jahre halten und für vielfältige Zwecke umfunktioniert werden können - etwa, indem man Trennwände und Raumhöhen so gestaltet, dass Räume ohne grossen Aufwand umgenutzt werden können.» Ein Problem ist, dass es bei heutigen Bauten so viel zu berücksichtigen gibt beim Umbau zu einer Neunutzung, dass viele Bauherrschaften sich sagen: Es ist einfacher, alles neu zu machen.
DDie gute Nachricht: Es gibt bereits Initiativen, insbesondere im Bauwesen. Die «Charta Kreislauforientiertes Bauen», ein Zusammenschluss von Schweizer Bauherrschaften und des Schweizerischer Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) setzen sich ehrgeizige Ziele für umweltfreundliches Bauen: Bis 2030 soll der Einsatz von nicht erneuerbaren Primärrohstoffen um 50 Prozent gesenkt, der Ausstoss grauer Treibhausgasemissionen erfasst und stark reduziert sowie die Kreislauffähigkeit von Sanierungen und Neubauten stark verbessert werden. Die Baubranche hat denn auch bereits damit begonnen, die Kreislaufwirtschaft anzugehen. «Mittlerweile gibt es innovative Firmen, die Beton oder Mischabbruch in Recycling-Anlagen stecken, die den Bauschutt auftrennen. Heraus kommt Recycling-Beton, dessen Einsatz in der Schweiz erfreulicherweise auf dem Vormarsch ist», erklärt Mertens. Sie ist überzeugt: «Ohne ambitionierte Ziele geht es nicht. Sie ermutigen dazu, etwas ernsthaft anzustreben. Wenn alle mitmachen, können wir Fortschritte erzielen. Vielleicht nicht genau die angestrebte Vorgabe, aber dennoch: Bemühungen um Verbesserung werden uns in jedem Fall weiterbringen.»
Informationen zur Ausstellung: Die Ausstellung «Das zweite Leben der Dinge – Kreislaufwirtschaft im Laufe der Zeit» ist noch bis 10. November im Landesmuseum in Zürich (www.landesmuseum.ch) zu sehen, vom 7. Dezember bis 27. April 2025 wird sie im «Forum Schweizer Geschichte Schwyz» in Schwyz (www.forumschschwyz.ch) gezeigt.
Informationen zum Buch: «Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit» von Roman Köster; erschienen 2024; Verlag C.H.Beck; 422 Seiten; ISBN 978-3-406-80580-6; Preis: zirka 41 Franken 90

Quelle: Schweizerisches Nationalmuseum
In einer Bauernstube am Abend um 1850: Die um den Tisch versammelten Personen sind mit typischen Feierabendarbeiten beschäftigt. Zwei Männer reparieren Werkzeug, sie schnitzen Holzzinken für einen Rechen und setzen sie ein. Die Frauen sticken und stricken.