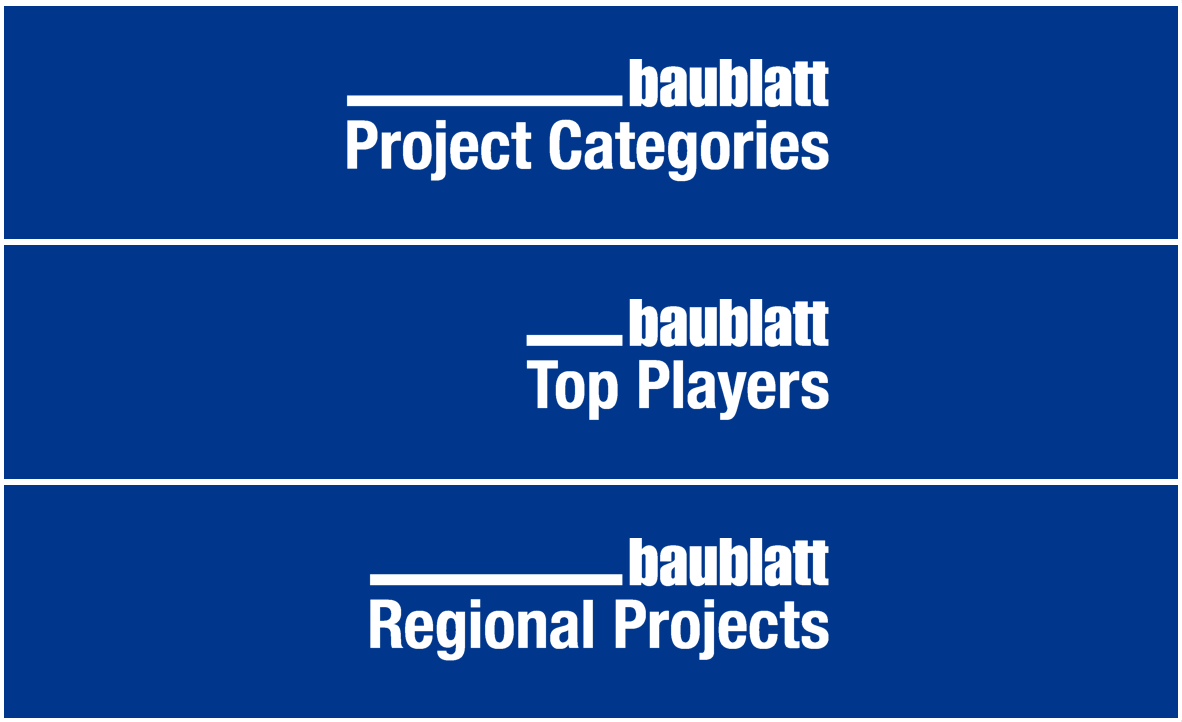Viel mehr Neophyten in Feuchtgebieten und mageren Wiesen
An der Art der Neophyten und an ihrer Verbreitung lässt sich der Wandel der einheimischen Pflanzenwelt ablesen. Und auch wie stark sich die wärmeren Temperarturen auswirken. Dies zeigt eine Studie der WSL und der Universität Zürich.
In China werden mit den Blättern des Götterbaums (Ailanthus altissima) die Seidenspinner gefüttert, die das Rohmaterial für Shantung-Seide liefern. Und in den waldarmen Regionen am Gelben Fluss zählt der Baum zu den Nutzhölzern. Seit rund 280 Jahren gibt es ihn auch in Europa: 1740 brachte der Jesuitenpater, der als Missionar in China unterwegs war, und Hobbybotaniker Pierre Nicolas le Chéron d’Incarville das Gewächs nach Europa. Heute zählt er in der Schweiz zu den Neophyten: Man findet in entlang von Autobahnen und in urbanen Gebieten; Er ist vergleichsweise resistent gegen Trockenheit, Salz und Pestizide, weswegen er im städtischen Umfeld gut überleben kann.
Doch wie wirken sich solche importierten Pflanzen auf die heimische Flora aus? Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer unter ihnen? Antworten liefert die Studie zum Wandel der Pflanzenwelt, für die ein Forschungsteam der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und der Universität Zürich. Aus dem Papier geht unter anderem hervor, dass einheimische Pflanzen in Feuchtgebieten und mageren Wiesen zurückgegangen sind, während überdurchschnittlich viele nicht einheimische Arten häufiger angetroffen werden. 66 Prozent dieser sogenannten Neophyten konnten sich in der Zeit zwischen den historischen und aktuellen Erhebungen ausbreiten. Von den einheimischen Arten gelang dies weniger als zehn Prozent.
19‘000 Einzelfund aus der Zeit zwischen 1900 und 1930
«Wir hatten das grosse Glück, dass für den Kanton Zürich gute Daten zur historischen Flora existieren», sagt Studienleiter Thomas Wohlgemuth von der WSL. Sein Team konnte auf insgesamt über 19'000 historische Einzelfunde aus der Zeit zwischen 1900 und 1930 zurückgreifen. Das erlaubte den direkten Vergleich mit der heutigen Pflanzenwelt, so Wohlgemut. Allerdings gingen die Ursachen der Veränderungen nicht daraus hervor. Um diese zu identifizieren, analysierten die Wissenschaftler die sogenannten ökologischen Zeigerwerte der Arten – Zeigerwerte beschreiben die ökologischen Ansprüche einer Pflanze in fünf Stufen von wenig nach viel. «Eins heisst beispielsweise, die Pflanze wächst an Orten mit kühlen Temperaturen, also in Hochlagen, und Fünf bedeutet, die Art hat es gern sehr warm», erläutert Wohlgemuth. Daneben gibt es auch Zeigerwerte, etwa für die Feuchtigkeits-, Licht- oder Nährstoffvorlieben der Pflanzen.
So ermittelten Wohlgemuth und seine Kollegen für ihre Studie die Zeigerwerte verschiedener Pflanzengruppen – etwa jene der einheimischen Pflanzen und die der Neophyten. Letztere erwiesen sich als deutlichste Indikatoren für die veränderten Lebensbedingungen im Kanton, wie Studienerstautor Daniel Scherrer erklärt. So deuten die Zeigerwerte der eingewanderten Pflanzen darauf hin, dass sie warme, trockene und nährstoffreiche Lebensräume bevorzugen. Ihr gehäuftes Auftreten in den entsprechenden Gebieten des Kantons spiegelt die Intensivierung der Landwirtschaft einerseits, aber auch die zunehmende Urbanisierung andererseits wieder, ebenso wie die damit verbundene Trockenlegung vieler Feuchtgebiete.
Wärmere Temperaturen, mehr Neophyten
Daneben zeigt die Studie auch klar auf, dass eben nicht nur die Landnutzungsänderung hinter dem Erfolg der Neophyten steht: «Die Zunahme der Neophyten hängt auch damit zusammen, dass es wärmer geworden ist», sagt Scherrer. Den Forschern ist es damit gelungen, ein Klimasignal im Florenwandel im Flachland nachzuweisen. Dort war es bisher schwer, den Klimaeinfluss von der Landnutzungsänderung zu trennen.
Der Vergleich der Zeigerwerte und globalen
Verbreitungsschwerpunkte der Neophyten und einheimischen Arten ergab einen
Unterschied in ihren Temperaturvorlieben von etwa 1,8 Grad. Dies entspricht in
etwa der seit vorindustrieller Zeit gemessenen Temperaturerhöhung von zwei Grad
im Kanton Zürich. «Einen kausalen Zusammenhang kann man hier aber nicht
herstellen: Viele der Neophyten waren schon vor 1900 vorhanden und andere sind
erst in den letzten paar Jahrzehnten dazugekommen», schränkt Scherrer ein.
«Aber trotzdem ist es spannend, dass sich die Zahlen decken.» (mai/mgt)

Quelle: Wikimediaimages, Pixabay
Der Götterbaum hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte auch in hiesigen Breitemgradem ausgebreitet.