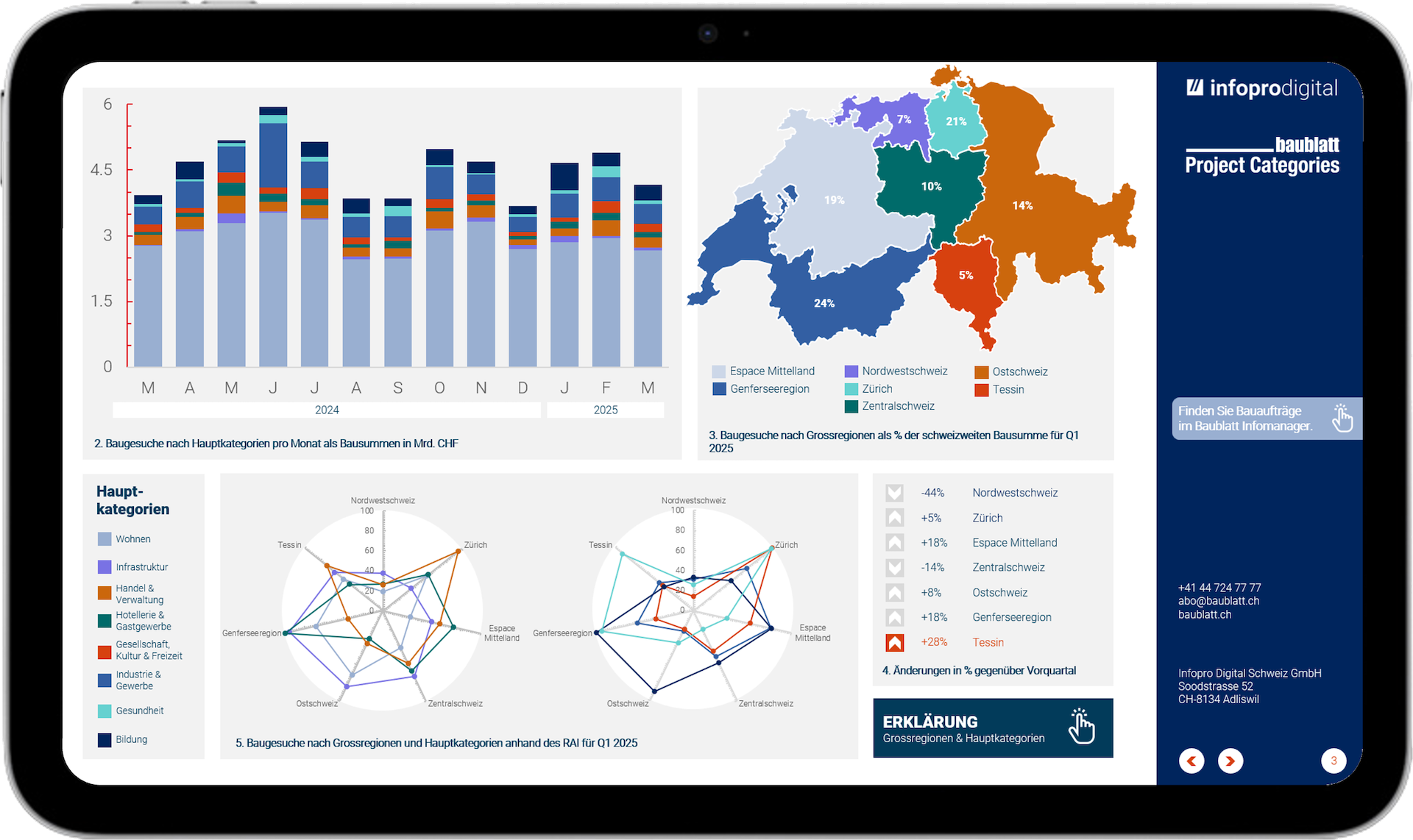Soziale Medien – muss das wirklich sein?
Facebook, Twitter und Co. verändern die Behördenkommunikation. Dabei kann man vieles falsch machen. An der Ostschweizer Gemeindetagung wurde eruiert, wie man in der digitalen Ära einen zeitgemässen Dialog mit den Bürgern führen kann. Und wo die Grenzen der sozialen Medien liegen.

Quelle: guruXOX/Fotolia
Diese jungen Frauen lesen kaum das Amtsblatt. Wie kann sie die Gemeinde trotzdem erreichen?
Weit über 1000 Tweets hat Donald Trump bereits abgesetzt, seit er zum US-Präsidenten gewählt wurde. Wahrscheinlich wird er als erstes «Social-Media-Staatsoberhaupt» in die Geschichte eingehen. Das Problem daran: Trump verwendet soziale Medien nur in eine Richtung, so wie sein geliebtes Fernsehen funktioniert: Ich spreche, ihr hört zu. Das Spannende an den neuen Medien ist aber, dass die in Vor-Internetzeiten existierende Trennung zwischen Sender und Empfänger aufgeboben wurde. Soziale Medien sind ausgesprochen interaktive Kanäle, die sich für einen niederschwelligen Dialog – etwa zwischen Bürger und Politik oder Verwaltung – sehr gut eignen.
Trump macht genau das Gegenteil: Auf Twitter hat er 41 Millionen Follower. Er selbst folgt gerade einmal 45 Personen. Die meisten davon sind Familienmitglieder, seine Minister oder Unterstützergruppen. Ganze 19 Mal hat er einen Tweet «geliked» – die meisten stammen von ihm selbst. Während seine Tweets jeweils von Tausenden kommentiert werden,
mischt sich Trump nur auf eine Weise in die Debatten ein: Er blockiert seine pointiertesten Kritiker.
Wenn also selbst der weltweit fleissigste Twitter-Politiker die Möglichkeiten seines Lieblingsmediums nicht einmal ansatzweise ausschöpft, wie sollen dann die Schweizer Gemeinden in der digitalen Welt einen sinnvollen Dialog mit den Bürgern pflegen? Diese Frage stand im Zentrum der siebten Ostschweizer Gemeindetagung des Ostschweizer Zentrums für Gemeinden (OZG) der Fachhochschule St. Gallen (FHS) in Gossau SG.
Kontrollverlust akzeptieren
Im Zeitalter der klassischen Medien übten diese die Kontrolle über Informationen aus. Das hatte den Nachteil, dass die Öffentlichkeit die Nachrichten nur gefiltert erhalten konnte. Heute kann jeder «News» publizieren und dabei wird es immer schwieriger, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Für die Medien, aber auch für Gemeinden, die eine Botschaft an ihre Bürger richten wollen, ist das ein gewisser Kontrollverlust.
Diesen müsse man aber angesichts der grossen Vorteile, welche die neuen Medien bieten, in Kauf nehmen, sagt Reto Eugster, Leiter des interdisziplinären Weiterbildungszentrums der FHS: «Wer in einem Flugzeug sitzt, weiss meist nicht genau, wie dieses funktioniert. Auch bei einer Operation muss man dem Arzt einfach vertrauen. Wir müssen mit dem Kontrollverlust leben, er ist Teil der modernen Gesellschaft.»
Wie alternativlos dieser Kontrollverlust ist, erläutert Eugster am Beispiel von Wetter-Apps: Jeder nutzt sie, weil sie sehr praktisch sind. Dass auch permanent der Standort und somit ein Bewegungsprofil sowie viele weitere Daten zum App-Betreiber fliessen, nehmen wir in Kauf ohne genau zu wissen, welche Daten es sind und was damit geschieht. Einfach nichts im Internet von sich Preis zu geben, sei auch keine Alternative: «Damit macht man sich erst recht verdächtig», so Eugster.
Er plädiert im Umgang mit dem Internet für einen «methodischen Optimismus»: Wie Hernán Cortes bei der spanischen Eroberung Mexikos im 16. Jahrhundert solle man die Schiffe versenken, die einen in die «alte Welt» zurückführen könnten. Anschliessend solle man die Zumutungen der neuen Welt, in diesem Falle den Kontrollverlust, akzeptieren. Dann kann man die Chancen des Neulands identifizieren und zu Nutzen beginnen. «Man merkt schnell, dass man als Gemeinde vieles nicht mehr tun muss. Man muss keine Bürgerplattformen mehr bauen, das hat Facebook schon getan. Aber vielleicht sollte man auf Facebook aktiv sein.»
Als Beispiel nennt Eugster die für die meisten Gemeinden existierenden Facebook-Gruppen «Du bist in XY aufgewachsen, wenn...». Diese werden oft sehr aktiv genutzt, was für die Gemeinde eine Chance zur Kommunikation mit Bürgern bietet. «Aber seien Sie bitte authentisch», warnt Eugster.
Für was eignet sich Facebook?
Die Politologin Adrienne Fichter, Redaktorin bei der «Republik», Dozentin an der FHS und Social-Media-Kennerin, hat eben das Buch «Smartphone-Demokratie» herausgegeben. Sie sieht in den sozialen Medien bezüglich Politik- und Verwaltungskommunikation realistischerweise sowohl Chancen als auch Risiken.
Ein Problem von Facebook ist laut Fichter, dass der Konzern eine Blackbox ist. Externe Forscher und Journalisten erhalten kaum Zugriff auf die Daten des Branchenprimus. Klar ist für Fichter aber: «Das Aufkommen von Facebook belebte die Demokratie und es ist ein unabdingbares Tool um gleichgesinnte zu finden, aber auch um Proteste zu organisieren und zu koordinieren», so Fichter.
So sei eine global an mehreren Standorten durchgeführte Demonstration wie der «Women's March» im Januar 2017 im Vor-Social-Media-Zeitalter kaum denkbar gewesen. Auch war das Sammeln von Unterschriften für Volksinitiativen in der Schweiz noch nie so einfach wie heute.
Auf der Webseite www.wecollect.ch kann man sich Unterschriftenbögen für diverse aktuelle Initiativen herunterladen. Diese muss man zwar noch physisch ausfüllen und unterschreiben, doch die Links zu Wecollect-Unterschriftenbögen machen in den sozialen Medien die Runde. Über Twitter, Facebook, Whatsapp und Co. landen immer mehr Bürger bei Wecollect. So seien laut Eigenangabe für die Vaterschaftsurlaubs-Initiative fast 60 000 Unterschriften über die Plattform gesammelt worden, was 60 Prozent der benötigten Menge ist. Ein Viertel der so unterschreibenden Bürger seien alleine via Facebook auf der Webseite von Wecollect gelandet.
Doch für komplexere Interaktionen sind die neuen Kommunikationskanäle laut Fichter nicht wirklich geeignet: «Die sozialen Netzwerke sind ein wertvolles Instrument für den Dialog und die Mobilisierung. Aber sie sind nicht geschaffen worden für einen demokratischen Diskurs.» Ein Grund dafür sind die den Algorithmen zu verdankenden Filterblasen, denn immer mehr interagieren, gerade auf Facebook, nur noch Gleichgesinnte miteinander. Umfragen zeigen, dass kontroverse Diskussionen von vielen Nutzern gar nicht gewünscht werden. Ein Ideenwettbewerb findet nicht statt, man liest und kommentiert nur, was einem gefällt und der eigenen Meinung entspricht.
Etwas besser für den öffentlichen Diskurs eigne sich Twitter. Dort ortet Fichter das Problem vor allem in den zahlreichen Bots, also automatisierten Konten, die fast wie richtige Menschen antworten. «Es gab einen Twitter-Bot, der Vorgab, die argentinische Präsidentin zu sein. Der Bot antwortete sehr realistisch. Nur aufgrund der Tatsache, dass er immer innert zehn Sekunden antwortete, auch in der Nacht oder während Regierungssitzungen, hat man entdeckt, dass der Account nicht echt sein kann.» Eine grosse Portion Skepsis und Vorsicht kann hier also nicht schaden.
Grosses Potenzial sieht Fichter hingegen bei Mitwirkungsverfahren über sogenannte Civic-Tech-Netzwerke, also spezialisierte Tools, über welche die Bürger ihre Meinung zu bestimmten Themen abgeben können.
Intelligente Fake News
Ein grosses Problem auf sozialen Medien sind bekanntlich Fake News. Während des US-Wahlkampfs im Herbst 2016 hatten laut einer Analyse des Newsportals Buzzfeed Fake-News-Inhalte ab August via Facebook eine höhere Interaktionsrate als die Inhalte der etablierten Medien – eine beängstigende Entwicklung.
Auch in Deutschland sah es im Vorfeld der Bundestagswahlen im Herbst 2017 nicht besser aus: Falsche Artikel über Bundeskanzlerin Merkel, etwa mit der von Merkel nie gemachten Aussage, man müsse Ausländergewalt akzeptieren, wurden öfters geteilt als solche, welche Fakten verbreiteten. «Anbieter von Fake News verstehen genau, wie man über Facebook Klicks generieren kann. Ihnen geht es auch sehr stark um Werbeeinnahmen, denn sie verdienen mit jedem Klick auf ihre Inhalte», sagt Fichter. Inhalte sind also für Fake-News-Anbietern oft sekundär – sie sind nur Mittel zum Zweck. Wenn sich mit jedem Klick Geld verdienen lässt, ist es egal, ob der Text wahr ist, solange die Leute darauf zugreifen.
Für die Behördenkommunikation, gerade in einer Ausnahmesituation, können Facebook und Twitter jedoch bestens eingesetzt werden. «Insbesondere die Polizeien machen das oft sehr gut. Als sich im Juli 2016 in einem Münchner Einkaufszentrum ein Terroranschlag ereignete, fanden sich viele Fake News in den sozialen Medien. Die Polizei hat über Facebook und Twitter sehr ruhig und sachlich informiert und die Bevölkerung dazu aufgerufen, den Fake News nicht zu glauben», so Fichter.
Auch fürdie permanente Behördenkommunikation seien die sozialen Medien gut geeignet. Um ein bestimmtes Projekt voranzutreiben aber eher weniger, dafür würden sich die Civic-Tech-Lösungen besser eignen. Verschliessen dürfen sich Politik und Verwaltung den Trends nicht, man müsse sich schon überlegen, wie Demokratie im 21. Jahrhundert funktioniere. «Oft wird noch mit Technologien des 19. Jahrhunderts gearbeitet», sagt Fichter.
Analoge Sinnlichkeit
Nach so vielen Inputs zur Digitalisierung war es am Soziologen Mark Riklin, Leiter der «Meldestelle für Glücksmomente» und FHS-Dozent, die Verbindung vom Digitalen zum Analogen wiederherzustellen. «Das Analoge hat eine im Digitalen nie erreichte Sinnlichkeit», strich er zum Beginn seiner Ausführungen hervor. Schon während den Tagungspausen hatte sich Riklin mit einer alten Schreibmaschine im Foyer des Fürstenlandsaals installiert und ein analoges Erlebnis ermöglicht.
Er glaubt, dass gerade die junge Generation das Analoge neu für sich entdecke, weil es in unserer digitalen Welt etwas Besonderes geworden ist. Eine These sei etwa, dass analoge Dinge bald so teuer werden, dass sich viele etwas Nicht-Digitales gar nicht mehr leisten können. Doch: «Das Analoge macht das Digitale oft erst möglich», sagt Riklin. Das eine bedingt also zwangsläufig das andere und kann nicht isoliert davon betrachtet werden.
Doch wie schaffen wir es, dass die digitale Welt der Gesellschaft mehr Nutzen stiftet, als dass sie schadet? Riklin sieht in diesem Zusammenhang drei wichtige Aspekte. «Wir müssen uns erstens der Chancen der Digitalisierung bewusst werden und diese möglichst gut nutzen. Zweitens mit ihren Schattenseiten möglichst geschickt umgehen und
drittens das Analoge nicht ganz vergessen.» Es gäbe einige Firmen, die intern einen «analogen Freitag» eingeführt hätten. An diesem Tag sind jeweils E-Mails an Arbeitskollegen tabu, man darf nur direkt miteinander kommunizieren. Das regt Riklin auch für Gemeindeverwaltungen an.
Immer wieder führt er auch Experimente in Firmen durch, etwa mit einem «Fahrstuhlsprecher», der im Lift Kurznachrichten oder News aus der Unternehmung vorliest. «Der Lift ist ein sehr lustvoller Raum, den wir viel vielseitiger nutzen könnten, um analog in Beziehung zueinander zu treten», sagt er.
Noch mag das einigermassen funktionieren. Es bleibt zu hoffen, dass auch in Zukunft überhaupt noch jemand realisiert, wer im Lift neben einem steht. Denn schon heute senken sich die Blicke der Mitmenschen gefährlich oft Richtung Smartphone. Hoffentlich auf innovative Bürgerservices der Gemeinde und nicht auf Fake News.