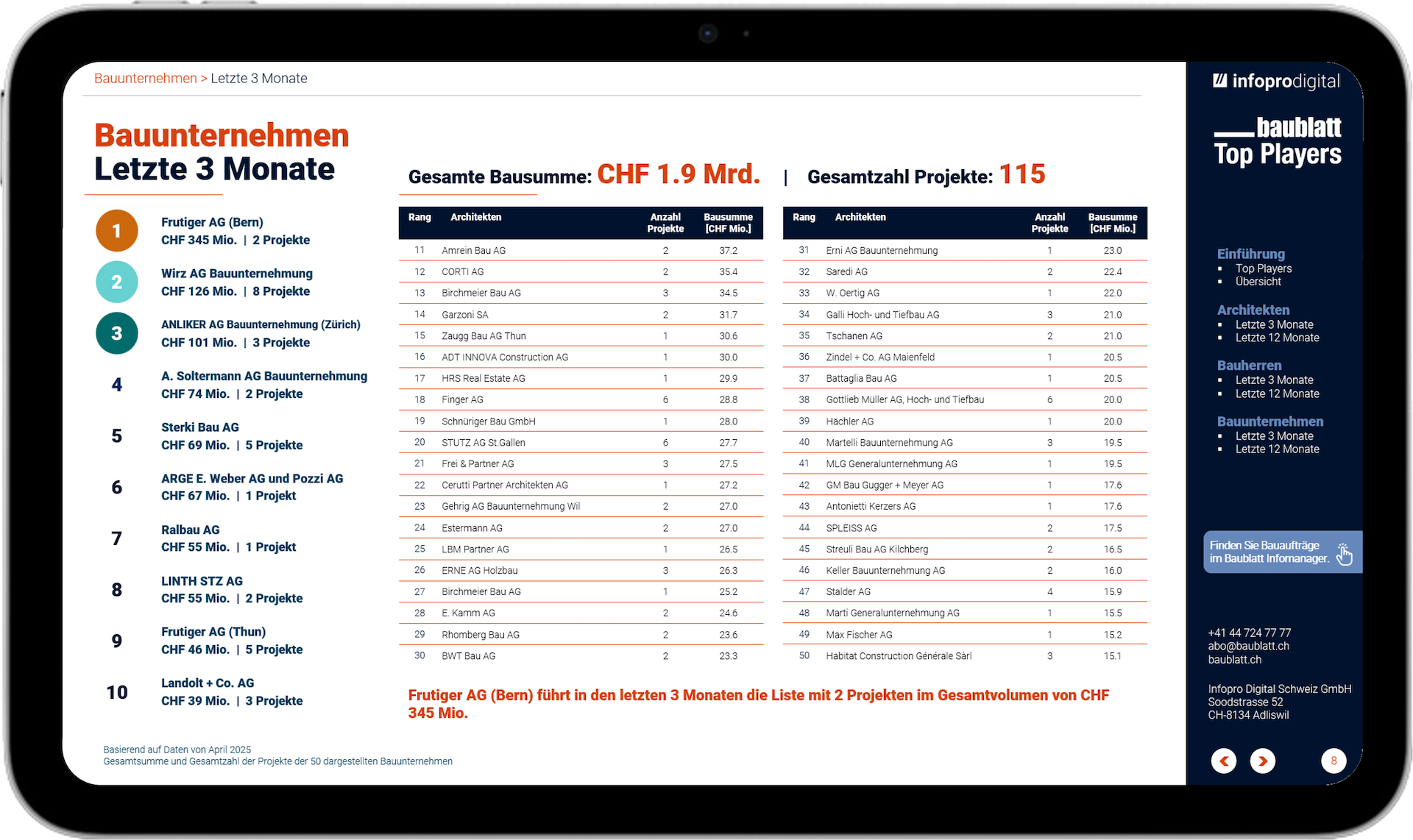Privatisierung der Trinkwasserversorgung
Sollen sich Privatinvestoren an der Wasserversorgung beteiligen können? Diese Frage sorgt derzeit besonders im Kanton Zürich für rote Köpfe. Ein Blick in die Gesetze zwischen den hitzigen Diskussionen zeigt die effektiven Optionen für Privatisierungen. Daraus ergeben sich auch die Chancen und Risiken für die Trinkwasserversorgung.

Quelle: nikkytok/Shutterstock
Die Trinkwasserversorgung ist ein emotionales Thema. Die Beteiligung von Grosskonzernen wie beispielsweise Nestlé ist für viele unvorstellbar.
Ein Passus über Privatisierungen in der Vorlage zum Zürcher Wassergesetz erregt derzeit Aufsehen. Die Debatte erinnert an die schrillen Töne aus der Ära der Liberalisierungen in den Neunzigerjahren.
Auf einer Seite warnen Globalisierungsgegner vor dem Ausverkauf der Wasserversorgung an Konzerne. Aus dem andern Lager erklingt das Credo vom schlanken Staat und dem freien Markt. Der Verband des schweizerischen Gas- und Wasserfachs (SVGW) schaltet sich eigens mit einem Positionspapier in die Diskussion ein.
In der Vorlage des Regierungsrats war die Welt noch in Ordnung. Demnach behielt der Staat bei Auslagerungen an privatrechtliche Gesellschaften die volle Kontrolle. Die bürgerliche Parlamentsmehrheit brachte jedoch eine Regelung durch, die Privatinvestoren Beteiligungen an der Wasserversorgung erlaubt, solange die Gemeinden zwei Drittel der Stimmrechte behalten. Konzerne wie Nestlé oder Veolia in der öffentlichen Trinkwasserversorgung, bei dieser Vorstellung wird für viele eine rote Linie überschritten. Das Zürcher Wassergesetz dürfte deshalb vors Volk kommen.
Welche Optionen gibt es?
Beim emotionalen Thema Trinkwasser hilft ein Blick in die nüchterne Welt der Rechtswissenschaft. Diese kategorisiert zum einen verschiedene Formen der Privatisierung. Zum andern stellt das Schweizer Recht bei der Auslagerung öffentlicher Aufgaben an private Gesellschaften Grundsätze auf.
Unter den Privatisierungsformen ist zunächst das öffentliche Unternehmen in privatrechtlicher Gestalt zu nennen. Üblich ist die Aktiengesellschaft, die durch ein Spezialgesetz geschaffen werden muss. Im Gesundheitsbereich werden so heute zunehmend Spitäler privatisiert, wobei die Gesellschaften meist zu 100 Prozent beim Kanton oder den Gemeinden verbleiben. Diese Form nennt man die Organisationsprivatisierung, bei der bloss ein privatrechtliches Gefäss geschaffen wird, an dem sich Private jedoch nicht beteiligen können. Darauf zielte der Zürcher Regierungsrat in seiner Vorlage zum Wassergesetz ab.
Sodann gehören gemischtwirtschaftliche Unternehmen zum Alltag staatlicher Aufgabenerfüllung. Diese sind durch teils staatliche und teils private Teilhaber gekennzeichnet, wobei der Staat in den meisten Fällen eine Kontrollmehrheit besitzt. Beispiele sind im Energiebereich zu finden, etwa mit der Axpo. Der Flughafen Zürich und die Basler Mustermesse sind ebenfalls gemischtwirtschaftliche Unternehmen. Diese Lösung schwebt dem Kantonsparlament für die Wasserversorgung der Zürcher Gemeinden vor, also keine blosse Reorganisation, sondern ein effektiver Einbezug privater Teilhaber.
Eine ebenso wichtige Rolle spielt die Übertragung von staatlichen Aufgaben auf reine Privatunternehmen, etwa im Strassenunterhalt oder in der Informatik. Hier regelt jeweils ein Erlass die Grundlagen, während in der Leistungsvereinbarung zwischen dem Gemeinwesen und der Firma das Kleingedruckte steht. Für die öffentliche Steuerung und Governance ist die Leistungsvereinbarung ein zentrales Element. Je nach Tragweite des Geschäfts ist sogar eine Monopolkonzession erforderlich, etwa im Bergbau oder öffentlichen Verkehr.
In der Praxis unbedeutend ist schliesslich die echte Privatisierung, bei der eine Aufgabe gar nicht mehr als öffentlich gilt und daher der Privatwirtschaft überlassen wird. So wurde etwa die Zürcher Staatskellerei vor rund 20 Jahren zum privaten Weinhandelsunternehmen.
An Grundrechte gebunden
Bleibt die Aufgabe staatlich, gilt es Grundsätze zu beachten. Zunächst braucht es für Auslagerungen eine gesetzliche Grundlage. Mit dem umstrittenen Wassergesetz wäre eine solche geschaffen. Zudem greift das Fusionsgesetz. Sodann gilt für die Unternehmen gemäss Bundesverfassung eine Grundrechtsbindung. Private Erbringer staatlicher Leistungen sind gleich wie die Zentralverwaltung zu Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung verpflichtet.
In der Summe kann die kommunale Trinkwasserversorgung also nur innerhalb der gesetzlichen Schranken ausgelagert werden, und die öffentlichen Interessen müssen gewahrt bleiben.
Brennende Fragen stellen sich jedoch schon im Vorfeld einer Privatisierung. Sollen überhaupt Privatinvestoren ins Boot geholt werden und welche Motive bestehen für eine Beteiligung am Service Public? Ist ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen das richtige Gefäss?
Der Corporate-Governance-Bericht des Bundes greift diese Fragen auf und ist damit auch für Gemeinden eine wichtige Richtschnur. Der Bericht empfiehlt für Dienstleistungen
mit Monopolcharakter die öffentlich-rechtliche Organisationsform der Anstalt, für Dienstleistungen am Markt die privatrechtliche Aktiengesellschaft.
Besteht Reformbedarf?
Der SVGW erblickt derzeit keinen Anlass für Privatisierungen. In seinem Positionspapier weist er zwar darauf hin, dass privates Engagement in der Wasserversorgung nichts Neues ist. Historisch bedingt existiere bereits eine Vielfalt, die vom klassischen Gemeindewerk über Genossenschaften bis zu Aktiengesellschaften mit und ohne private Aktionäre reiche.
Zudem stehe die Wasserversorgung sowohl qualitativ als auch finanziell gut da, mit einem Infrastrukturwert von 50 Milliarden Franken landesweit und jährlichen Investitionen von über 900 Millionen Franken. Deshalb bestehe kein Reformbedarf. Im Gegenteil warnt das schweizerische Gas- und Wasserfach vor gewinnorientierten Unternehmen in einem klassischen Monopolbereich. Das Kostendeckungsprinzip in der Wasserversorgung stehe Profitstreben entgegen. Gescheiterte Experimente mit Konzernbeteiligungen in Paris und Berlin würden dies belegen.
Auch die Befürworter argumentieren mit dem Kostendeckungsprinzip. Dieses verhindere eigentliche Profite, weshalb von Privaten keine Gefahr ausgehe. Warum sollte dann aber ein Konzern einsteigen? Wie ein Blick in die Statistik zeigt, lässt sich mit dem Kostendeckungsprinzip durchaus spielen, besteht doch eine markante Preisspanne von 50 Rappen bis fast 3 Franken pro Kubikmeter Wasser.
Ein anderes Argument der Befürworter ist, dass viele Wasserversorger Teile von Verbundwerken sind. Während in den Sparten Strom- und Gasversorgung die Liberalisierung voranschreite, seien private Beteiligungen an den Wasserwerken ausgeschlossen, was zur Abspaltung dieser Einheiten führe. Auch dieses Argument lässt aufhorchen. Bei Gas und Strom spielt in unterschiedlichem Mass der Wettbewerb. Innerhalb des regulatorischen Preisbandes werden nicht nur Gewinne, sondern auch massive Verluste eingefahren, wie es der Alpiq-Konzern verdeutlicht.
Beim Trinkwasser dürfte der Wettbewerb schwer realisierbar sein, da es sich weder weit transportieren noch von verschiedenen Anbietern einspeisen lässt. Gleichzeitig sind finanzielle Reserven und eine wertvolle Infrastruktur vorhanden. Der Druck auf eine offene oder verdeckte Querfinanzierung der anderen Sparten würde daher mit privaten Anteilseignern steigen.
Wegen dieser Aspekte allein muss ein Wassergesetz allerdings nicht gleich an der Urne scheitern. Den Gemeinden werden ja keine Privatisierungen aufgezwungen, sondern sie bestimmen autonom über jede Reorganisation. Die Gemeindeversammlungen sind aber gut beraten, wenn sie genau prüfen, wem sie den Schlüssel zum blauen Gold in die Hände legen.