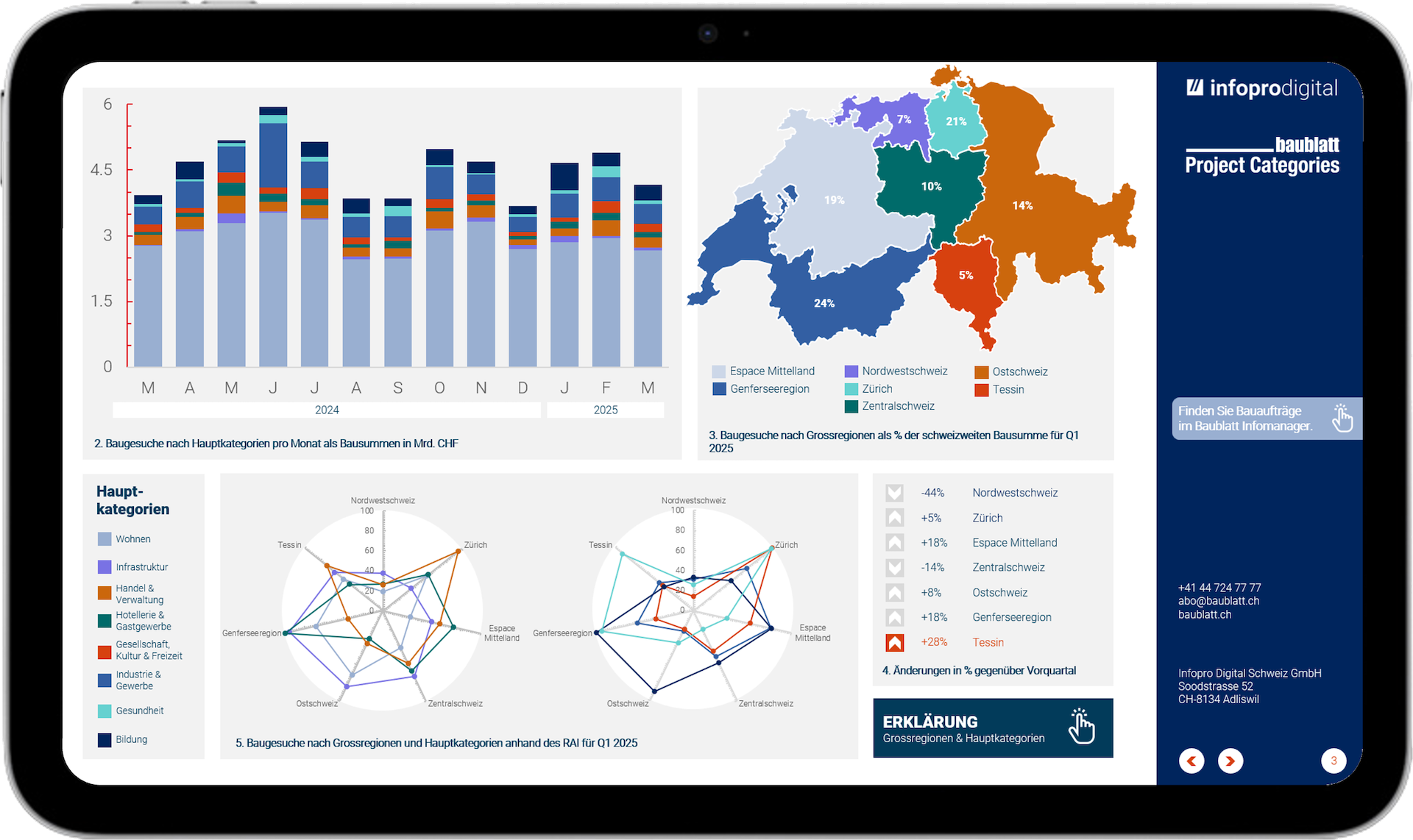Interkulturelle Kompetenz: Die «Kulturbrille» ablegen
Der Kontakt zwischen Behörden und Bürgern birgt nicht selten ein gewisses Konfliktpotenzial – vor allem wenn die Betroffenen aus fremden Kulturkreisen kommen und sprachliche Hürden die Kommunikation erschweren. Weiterbildungen zum Thema interkulturelle Kompetenz sollen Gemeindemitarbeitern dabei helfen, besser mit solch konfliktträchtigen Situationen umzugehen.

Quelle: sshegeda/Pixabay
Wer bei Beratungsgesprächen die «Kulturbrille» weglegt und nicht nur auf Kulturunterschiede fokussiert, kann der ohnehin schon komplexen Situation besser gerecht werden.
Der Kundenkontakt ist für Behördenmitarbeiter nicht immer leicht. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Interessen, die hier aufeinander prallen, gänzlich verschieden sind. Der Verwaltungsangestellte möchte seinen Job gut machen, leidet gleichzeitig unter Zeitdruck, hat spezifische Vorgaben zur Fallbearbeitung und möchte seine Dossiers sachorientiert und effizient erledigen.
Auf der anderen Seite steht ein Bürger, dem es um sein ganz persönliches Interesse geht. Die allgemeinen Vorgaben, die der Verwaltungsangestellte zu beachten hat, interessieren ihn nicht. Er wünscht sich einen positiven Bescheid ebenso wie ein verständnisvolles Gegenüber, sei dies in der Sozialhilfe, im schulischen Kontext, auf dem Betreibungsamt oder im Kontakt zum Steueramt. Das Machtgefälle ist meist offensichtlich. Schnell besteht die Gefahr, dass der betroffene Bürger sich unfair behandelt oder nicht ernst genommen fühlt.
Solche Situationen bergen von Grund auf Konfliktpotenzial und können zur täglichen Herausforderung werden – und das bereits ohne kulturelle Unterschiede und sprachliche Hürden, mit denen Behördenmitarbeiter immer mehr konfrontiert sind. Spätestens wenn diese hinzukommen, wird die Sache besonders komplex.
Professioneller Auftrag
«Fachpersonen auf den Verwaltungen haben zunehmend Kunden mit Migrationshintergrund. Die demografische Entwicklung gibt dies vor und das wird auch nicht abnehmen, im Gegenteil», sagt Svenja Witzig vom Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte (Tikk). In diesem Zusammenhang würden sich immer wieder Herausforderungen ergeben, die Gemeindeangestellte und andere Fachpersonen an ihre Grenzen bringen. Darunter leide auch die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. Das Thema interkulturelle Kompetenz setzt an diesem Punkt an.
Interkulturelle Kompetenz ist – so weiss Wikipedia – die «Fähigkeit, mit Individuen und Gruppen anderer Kulturen erfolgreich und angemessen zu interagieren». Diese Fähigkeit wird im täglichen Kontakt zwischen Behördenmitarbeitern und Bürgern immer wichtiger. Das zeigt auch das steigende Interesse an Seminaren und Weiterbildungskursen in diesem Bereich, wie sie das Tikk anbietet. «Heute verlangt man von einer Verwaltung, dass sie kundenorientiert, persönlich und effizient ist. Beim Thema interkulturelle Kompetenz geht es darum, diesen professionellen Auftrag richtig zu erfüllen», ist Witzig überzeugt.
Gemeindespezifische Kurse
Um Fachpersonen, Organisationen und die öffentliche Hand in Sachen interkulturelle Kompetenz fit zu machen, bietet das Tikk Beratungen und Weiterbildungskurse an, die auf die Bedürfnisse der Gemeinde respektive der teilnehmenden Mitarbeiter zugeschnitten sind. Die gemeindespezifischen Seminare können sowohl für die ganze Belegschaft als auch lediglich für Fachpersonen einer besonders betroffenen Abteilung durchgeführt werden.
In der Bodenseeregion etwa haben sich Gemeinden und Städte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen, um ihren Lernenden im zweiten Lehrjahr das Thema interkulturelle Kompetenz näherzubringen. In einem internationalen und interdisziplinären Setting besuchen die Auszubildenden gemeinsam einen zweitägigen Kurs, bei dem sie den professionellen Umgang mit Vielfalt erlernen und eigene Verhaltensweisen reflektieren sollen.
Das Konzept für den Kurs hat Svenja Witzig vom Tikk vor 10 Jahren entwickelt. Die Weiterbildung für die Lehrlinge der Bodensee-Anrainer-Gemeinden ist allerdings ein Spezifikum dieser Region, das ursprünglich aus einem EU-Projekt entstanden ist. In der Regel richten sich die Tikk-Seminare an ausgelernte Gemeindeangestellte.
Andere Perspektive einnehmen
Neben dem Beratungsangebot für den beruflichen Alltag ist das Tikk auch Anlaufstelle für betroffene Privatpersonen, die mit Rassismus, Diskriminierung oder sonstigen interkulturellen Konflikten konfrontiert sind. Deshalb kann sich das Tikk die Erfahrungen und Perspektiven von beiden Seiten zunutze machen: «Wir beschäftigen uns mit den Fällen, bei denen Fachpersonen an ihre Grenzen kommen und um Coaching beten. Aber genauso mit Menschen, die sich bei uns über die Verwaltungen beschweren», erklärt Witzig. Und auch wenn kein Seminar gleich ist wie das andere, im Kern geht es stets genau darum: den Perspektivenwechsel.
Ursprung des Konflikts wird in der Kultur gesucht
Wieso ist diese Auseinandersetzung mit den Anliegen des Gegenübers im Kontext der Behördentätigkeit so wichtig? Damit beschäftigt sich auch die Integrationsbeauftragte von Kreuzlingen, Zeljka Blank-Antakli, die ebenfalls in die Lehrlings-Seminare am Bodensee involviert ist: «Häufig wird ein Problem zwischen zwei Parteien aus einer Kulturperspektive betrachtet», sagte sie an der 5. Basler Fachtagung Integration.
Seminarteilnehmer wünschten sich regelmässig Informationen zur Kultur ihrer Kunden und Bürger. «Sie möchten, dass man ihnen beibringt, wie sie kulturelle Codes, die Werte und Normen anderer Länder, entschlüsseln können. Sie möchten wissen, wie die Menschen aus diesem oder jenem Land ticken.» Der Ursprung des Konflikts werde häufig irgendwo in der Kultur, in der Prägung und in den dahinterstehenden Werten der betroffenen Personen gesucht. «Dabei wird die kulturelle Prägung in der Regel als fixe Eigenschaft verstanden», so Blank-Antakli.
Fokus auf Fremdheit blockiert
Durch die Konzentration auf das Anderssein werden Verhaltensweisen einer Person mit Migrationshintergrund anders interpretiert als von jemandem mit Schweizer Abstammung. Blank-Antakli spricht dabei von einer «Kulturbrille», durch die hindurch das Verhalten der Person mit Migrationshintergrund erklärt werde.
Auch Svenja Witzig vom Tikk kennt dieses Problem gut: «Wenn es zu Konflikten kommt, besteht die Gefahr, dass Schweizer Fachpersonen das Problem oder Verhalten der ‹fremden› Person rein kulturell verorten, also ‹kulturalisieren›. Dann wird der Konflikt auf den vermeintlich kulturellen Unterschied zwischen den Beteiligten reduziert.» Das verunmögliche, andere wichtige Einflussdimensionen zu erkennen und somit auch eine adäquate Lösungsfindung, da die Situation als statisch betrachtet werde. «Es ist dann einfach so. Die Kunden werden so bloss noch als ‹schwierige Ausländer› wahrgenommen. Im Stil von: Die Person X kommt aus dem Land Y und dort ist das eben so. Punkt.»
Annahmen versus Realität?
Für die Seminare bedeutet das, dass anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis versucht wird, alle möglichen Faktoren aufzutrennen, um dem wirklichen Problem auf den Grund zu gehen. «So merkt man teilweise plötzlich, dass die kulturellen Hintergründe bei einem konkreten Konflikt gar nicht so gewichtig waren», so Witzig. Mit Beispielen, die Verwaltungsangestellte aus dem Alltag kennen, soll dabei aufgezeigt werden, dass das Konfliktpotenzial nicht immer nur im kulturellen Hintergrund zu verorten ist.
In den Konflikten lassen sich gewisse Muster erkennen. Häufig thematisiert werden etwa die folgenden Beispiele:
■ Es kommt immer wieder vor, dass Klientinnen der Sozialhilfe den Ehemann und weitere Angehörige zum Beratungsgespräch mitnehmen. «Das kann etwa damit zusammenhängen, dass sich die Betroffene davon mehr Sicherheit verspricht. Das muss nicht gleich ein An-zeichen dafür sein, dass die Frau in irgendeiner Form unterdrückt wird», betont die Kreuzlinger Integrationsbeauftragte Blank-Antakli.
■ Die fehlende Kooperationsbereitschaft eines Bürgers kann ihren Ursprung beispielsweise darin haben, dass die Person schon vielfach «institutionelle Abwertung» erlebt hat. «Dann hat das Problem gar nichts mit mir als Mitarbeiterin zu tun», so Blank-Antakli. Wer den Konflikt dabei «kulturalisiert», könnte zum Beispiel auch meinen, der Kunde habe Probleme mit einer weiblichen Mitarbeiterin. Eine Reihe von negativen Erfahrungen mit Behörden kann jedoch genauso bei einer Person mit Schweizer Kultur und Abstammung an der Kooperationsbereitschaft nagen.
■ «Nehmen zugewanderte Eltern nicht am Elternabend teil, kann das mit einem Fremdheitsgefühl oder einem an-deren Verständnis des Schulsystems zusammenhängen», erklärt Blank-Antakli weiter. Das Nichterscheinen könne aber beispielsweise schlicht darauf zurück-zuführen sein, dass die Verantwortlichen der Schule nicht genügend deutlich kommunizierten, was eigentlich der Sinn und Zweck einer solchen Veranstaltung ist und weshalb die Anwesenheit der Eltern verlangt wird.
Die Kulturalisierungsfalle vermeiden
Das Hauptziel der Weiterbildungskurse ist, den Verwaltungsangestellten mit Beispielen Anlass dazu zu geben, die eigenen Arbeitsweisen und Denkmuster zu reflektieren. Sie sollen dabei lernen, trotz hoher Fallzahlen und klarer Vorgaben mit konfliktträchtigen Situationen professionell umzugehen, vorschnelle Interpretationen zu hinterfragen und ihre Handlungsoptionen zu erweitern.
Besonders in Sachen Handlungsspielraum stelle sie immer wieder Unterschiede in der Fallbehandlung fest, je nach dem ob es sich um Schweizer oder ausländische Personen handle, berichtet Witzig. So etwa beim Verdacht auf häusliche Gewalt und der damit verbundenen Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb): «Bei unklaren, nicht gravierenden Fällen in Schweizer Familien wird zu Beginn eher das Gespräch gesucht, bevor eine Meldung an die Kesb erfolgt. Bei ausländischen Familien passiert es öfter, dass niemand mit der Familie gesprochen hat und diese völlig überrumpelt wird, nachdem der ganze Apparat in Gang gesetzt wurde.»
Selbstverständlich gebe es Fälle, bei denen das durchaus das richtige Vorgehen sei – unabhängig von der Herkunft der Familie. Es lohne sich aber, die Kontrollfrage «Wie würde ich bei einer Schweizer Familie vorgehen?» zu stellen, um sich der eigenen Handlungsoptionen bewusst zu werden. «Dies hilft, mehr Sicherheit zu gewinnen und zu vermeiden, dass man vorschnell in die Kulturalisierungsfalle tappt.»