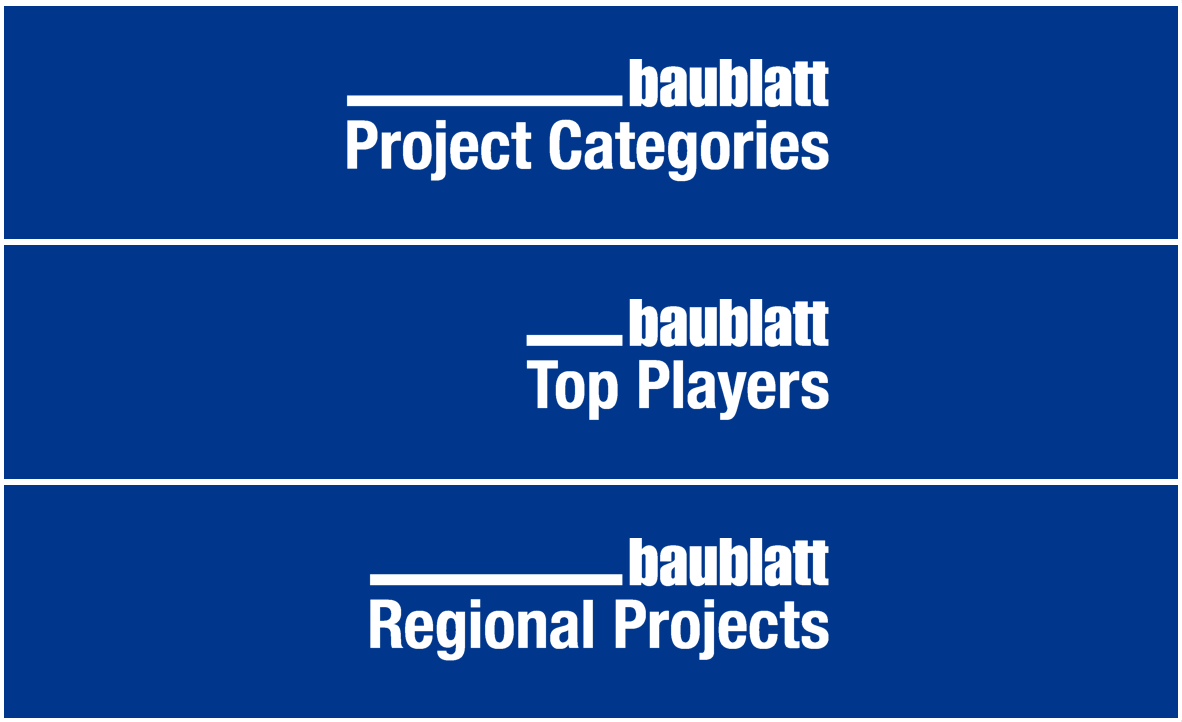Gründächer und Teiche: Stadtnatur braucht vernetzte Lebensräume
Für den Erhalt der Biodiversität im Wasser und an Land braucht es ökologisch hochwertige Naturflächen, die miteinander vernetzt sind. Allerdings fehlt es vor allem im Siedlungsgebiet oft an der dafür nötigen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren. Das zeigt eine neue Studie im Rahmen der Forschungsinitiative «blau-grüne Biodiversität» der Eawag und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL ).

Quelle: Rawpixel
Je nachdem ob sich ein Gewässer im besiedelten Gebiet befindet oder inmitten der Natur, gibt es bei der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren Verbesserungsbedarf.
Immer weniger finden Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen intakte Lebensräume – auch in der Schweiz. Zwar gibt es Schutzgebiete, die übers ganze Land verteilt sind. Aber sie werden, wie Giulia Donati, Postdoktorandin am Wasserforschungsinstitut Eawag erklärt, langfristig wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Biodiversität zu erhalten. Deshalb werde es immer wichtiger, auch Naturflächen ausserhalb von Schutzgebieten zu erhalten oder aufzuwerten und sie so miteinander zu vernetzen, dass der Austausch zwischen den einzelnen Beständen gesichert sei, sagt die Wissenschaftlerin.
In einer Studie, die kürzlich in der Fachzeitschrift «Conservation Letters» veröffentlicht worden ist, untersuchte ein Forschungsteam um Donati, wie der Schutz solch ökologischer Netzwerke mit der Kooperation zwischen den verschiedenen Beteiligten zusammenhängt – zum Beispiel Behörden, Naturschutzorganisationen und Landnutzern. Donati dazu: «Ein Netzwerk von Lebensräumen ist stets verbunden mit einem Netzwerk von Menschen.» So geht etwa die Lebensraum-Qualität eines Waldrands auch mit den diversen Akteuren einher: Wie bewirtschaftet das Forstamt den Wald? Was sät der Bauer oder die Bäuerin auf der angrenzenden Landwirtschaftsfläche? Und wie verhalten sich Spaziergängerinnen und Spaziergänger?
Für ihre
Untersuchung konzentrierte sich das Team auf Lebensräume an der
Schnittstelle zwischen Wasser und Land, auf so genannte «blau-grüne
Systeme». Dazu gehören aquatische respektive blaue Ökosysteme wie Flüsse,
See oder Tümpel und «grüne» Landökosysteme wie Wälder, Wiesen, Parks
oder Gärten. - Das Projekt war Teil der Forschungsinitiative «Blau-grüne
Biodiversität» der Eawag und der Eidgenössische Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL.
Auf der Spur von Kröten, Fröschen und Molchen
Donati und ihre Kollegen analysierten solche Lebensräume in drei Gebieten im Aargau und im Kanton Zürich, konkret in den Regionen Aarau, Baden-Brugg und Greifensee. Als Forschungsobjekt respektive als Beispiel für eine Organismen-Gruppe, die auf «blau-grüne» Gebiete angewiesen ist, wählten sie Amphibien wie Frösche, Kröten und Molche. Sie modellierten und analysierten, wo und in welchen Landschaftselementen Amphibien leben können und wie gut diese Gebiete miteinander verknüpft sind. Diese ökologischen Netzwerkmodelle ergänzten sie mit einer Umfrage bei rund 180 in den drei Regionen tätigen Organisationen, wie der Stadtplanung, dem Umweltschutz, der Forst- oder Landwirtschaft, aber auch der Jagdgesellschaften, Schrebergarten-Vereine oder Kiesgrubenbetreiber. Sie alle wurden gefragt, ob und wo sie in die Bewirtschaftung dieser blau-grünen Infrastruktur involviert waren und mit welchen anderen Organisationen sie dabei kooperieren.
Dabei zeigte sich ein
deutlicher Unterschied zwischen der gemeinsamen Bewirtschaftung von
zusammenhängenden blau-grünen Gebieten im ländlichen und im städtischen
Raum: Bei ländlichen, eher natürlichen Elementen stellten das Forschungsteam eine relativ
gute Abstimmung zwischen Naturschutzorganisationen, Behörden und
Landnutzern fest. In urbanen Räumen sah es anders aus: Hier fehlte es oft an klarer
Zuständigkeit und Kooperation. Eine mögliche Erklärung für diese
Diskrepanz: Für «blau-grüne» Naturschutzprojekte sind ausserhalb des
Siedlungsgebietes viel langjährigere Erfahrungen vorhanden. Behörden,
Naturschutzorganisationen, Land- und Forstwirtschaft sind sich gewohnt,
für die Aufwertung etwa eines Teiches am Waldrand oder eines Bachlaufs
mitsamt angrenzendem Wiesland zusammenzuarbeiten. (mgt/mai)