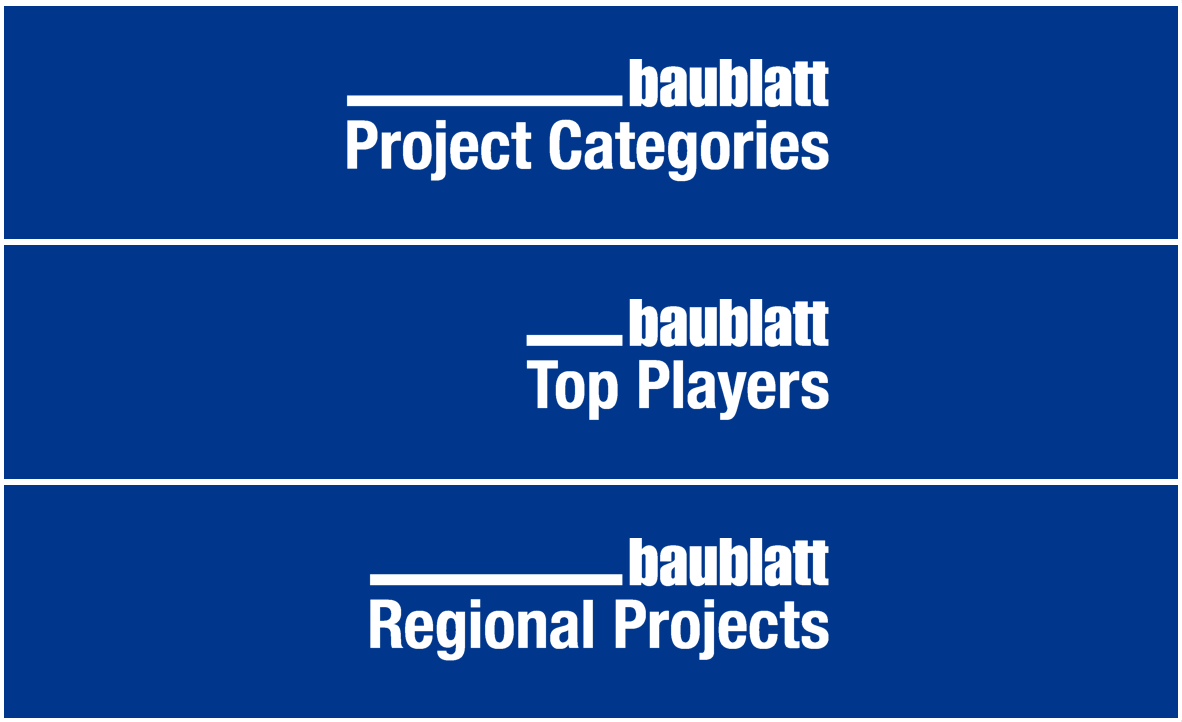Gemeinsame Dienste für die Zukunft
VON PATRICK AESCHLIMANN
Anfang November donnerte ein 80-Kubikmeter-Felsbrocken auf die Julierpassstrasse zwischen Rona und Mulegns GR. Bundesrätin Doris Leuthard nutzte dieses Unglück, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, bei ihrer Eröffnungsrede am nationalen E-Government-Symposium als ungewöhnliches Beispiel für den Nutzen gemeinsamer, föderaler E-Government-Projekte. «Aus diesem Felssturz kann man für die Zukunft zwei Handlungsstränge ableiten: Entweder man investiert in teure Schutzinfrastrukturen wie Tunnels und Galerien, oder man installiert ein IT-basiertes Alarmsystem für das Risikomanagement.» Zweiteres sei erfahrungsgemäss sicher günstiger. Das Problem: Es existiert keine gemeinsame Datengrundlage von Bund, Kantonen und Gemeinden, um diese Risiken zu erfassen. In solchen sogenannten Shared Services liegen in der föderalen Struktur der Schweiz noch die grössten Potenziale in Sachen E-Government brach. «Man spricht immer von Kostenreduktion durch Informations- und Kommunikationstechnologien. Die sind aber oft schwer erkennbar, da die IT-Budgets in den Verwaltungen steigen und steigen», sagte Leuthard. Die UVEK-Vorsteherin appellierte an die Anbieter, Nutzen und Effizienzgewinne besser aufzuzeigen. Auch die Verwaltungen nahm die Magistratin, angesichts des Insieme-Debakels in der eidgenössischen Steuerverwaltung, zur Brust: «Das Controlling muss zunehmen, Strukturen und Projekte sind noch vermehrt zu Hinterfragen.»
Einen Blick über den Tellerrand warf anschliessend Gerhard Popp, Sektionschef IT, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im österreichischen Bundesministerium für Finanzen. Er stellte die IKT-Konsolidierungsinitiative unseres Nachbarlandes vor, das wie die Schweiz eine stark föderale Struktur hat. Zumindest auf Stufe Bund sollen, hauptsächlich aus Spargründen, die IKT-Lösungen und -Verfahren vereinheitlicht werden. Bemerkenswert sind aus Schweizer Warte vor allem zwei Punkte: An Stelle einer zusätzlichen Authentifizierungslösung wie der «SuisseID» setzen unsere östlichen Nachbarn primär auf die Handysignatur, wie sie auch die Swisscom mit ihrer Mobile ID anstrebt.
Transparenz bei Subventionen
Österreich sei der «Europameister im Subventionieren», sagte Popp. Tatsächlich sind die Zahlen eindrücklich: 74 Milliarden Euro Fördergelder oder 26 Prozent des BIP verteilt Österreich pro Jahr um. Die 2600 Förderprogramme auf Bundesebene werden ergänzt durch 3100 auf Länderebene und gar 47 000 auf Gemeindeebene. «Ob diese Transferleistungen, Sozialversicherungen und andere Unterstützungen auch bei den richtigen Personen ankommen und nicht doppelt ausbezahlt werden, haben wir bis vor kurzem nicht gewusst», so Gerhard Popp. Mit der eingeführten Transparenzdatenbank hat sich das geändert: Jeder Verwaltungsangestellte kann heute bei einem Förderantrag kontrollieren, ob dem Kunden die Subventionen auch zustehen und sie nicht schon einmal ausbezahlt wurden. Andererseits kann sich auch der Bürger darüber informieren, welche Fördergelder er beanspruchen kann. Das Projekt wurde heuer mit dem «E-Government-Preis der deutschsprachigen Länder» in der Kategorie innovativstes Projekt ausgezeichnet.
Mangelnde Rechtsgrundlagen
Herausforderungen bei der Implementierung effizienter föderaler E-Government-Strukturen sind die mangelhaften Rechtsgrundlagen, sowie die fehlende Sensibilität der technisch orientierten Berufsleute für die rechtliche Seite und umgekehrt jene der Juristen für die technischen Aspekte. Auf diese Problematik machte Urs Paul Holenstein, Leiter des Fachbereichs Informatik im Bundesamt für Justiz, aufmerksam: «Die juristische Seite schafft es nicht, eine brauchbare Hilfe oder Anleitung zur Überwindung der rechtlichen Hindernisse zu vermitteln. Auf technisch-organisatorischer Seite fehlen hingegen oft minimale Kenntnisse grundlegender rechtlicher oder rechtspolitischer Konzepte oder Prinzipien, wie dem Legalitäts- oder Verhältnismässigkeitsprinzip, respektive der Zweckbindung.»
Die auf Informatik-, Internet- und Telekommunikationsrecht spezialisierte Anwältin Ursula Widmer gab Holensteins Kritik an den Juristen teilweise Recht: «Wir müssen lernen, so zu sprechen, dass jeder uns versteht.» Noch schwieriger werden die rechtlichen Aspekte in Zusammenhang mit Cloud-Computing. Je nach dem, ob man die Software (SaaS), die Plattform (PaaS), oder die Infrastruktur (IaaS) aus der Cloud bezieht, ändern sich die Rechtsgrundlagen. Für die Schweiz mache es keinen Sinn, ihre eigenen Regulierungen zu erlassen, da das Cloud-Geschäft höchst international funktioniere und die Interoperabilität gewährleistet werden müsse, so Widmer. Sie ermutigte die Verwaltungen, den Gang in ausländische Clouds zu wagen: «Mit einer Schweizer Lösung sind lediglich der Standort und der Gerichtsstand geklärt. Aber auch luxemburgisches oder irisches Recht stammt nicht aus dem Tierreich.»
Michael Keller, neuer Programmleiter von «eZürich», brach eine Lanze für die Gemeinden: «Sie sind von den oberen föderalen Ebenen etwas im Stich gelassen. Die Entscheidungen über Shared Services und Cloud Computing werden weiter oben, ohne grosse Mitwirkungsmöglichkeiten für die Kommunen gefällt.»
Daten künftig im Ausland?
Zum Schluss der Veranstaltung übte Reinhard Riedl, Leiter des E-Government-Instituts an der Berner Fachhochschule (BFH), Kritik an der Situation in der Schweiz: «Die vielen Parallelentwicklungen werden als gesunder Wettbewerb betrachtet, bremsen aber die Innovationskraft. Sie freuen nur die Anbieter, nicht aber die Staatskasse. Für kleinere Gemeinden wäre eine Reduktion der Komplexität wichtiger.» Auch Riedl fordert eine Abkehr vom Denken, dass alle Daten auf Schweizer Servern liegen müssen. «Es ist eine Illusion, dass es den finanziellen Druck in der Schweiz nicht gibt. Europäische Standards müssen auch bei uns akzeptiert und angenommen werden. Die Clouds mit unseren Daten werden aus Kostengründen künftig nicht mehr alle in der Schweiz domiziliert sein.» In Zukunft, da waren sich Riedl und die Anwesenden Anbieter einig, wird das Identitätsmanagement (IAM) für die Verwaltungen immer wichtiger werden – eine Herausforderung für die Zusammenarbeit der föderalen Ebenen, aber auch eine grosse Chance.
Die Krux mit dem elektronischen Umzug
Rund 500 000 Personen ziehen in der Schweiz pro Jahr um. Nebst allen organisatorischen Herausforderungen, die ein Umzug mit sich bringt, erwartet der Staat vom Bürger in dieser intensiven Zeit auch noch, dass er sich bei der alten Gemeinde persönlich ab- und bei der neuen wieder anmeldet. Kein Wunder ist der E-Umzug in Umfragen die am häufigsten gewünschte elektronische Behördendienstleistung. Folgerichtig wurde sie in den Katalog der priorisierten E-Government-Vorhaben aufgenommen. Die Umsetzung erweist sich hingegen als schwierig. Die Gründe dafür erläuterte Marcel Alder, Leiter Produktmanagement bei der Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG), im Rahmen der Fachsessionen des E-Government-Symposiums.
Was für den Bürger auf den ersten Blick eine simple Handlung ist, löst im Hintergrund eine wahre Flut von Unterstützungsprozessen aus, deren Schnittstellen oft noch nicht kompatibel sind. So muss ein Neuzuzüger mit dem Personenstandregister Infostar abgeglichen, mittels eidgenössischem Gebäude- oder Wohnungsidentifikator (EGID/EWID) überprüft, seine Krankenversicherung kontrolliert, die Zentrale Ausgleichsstelle für AHV/IV (ZAS) abgefragt und gegebenenfalls auch das Migrationsamt informiert werden.
Neun «eCH»-Standards kommen in diesen Prozessen zur Anwendung. Gegen 40 verschiedene Software-Lösungen für die Einwohnerregister sind auf dem Markt. Nicht alle sind mit sämtlichen Standards kompatibel. Zudem sind auch die kantonalen Personenregister unterschiedlich geregelt: Einige benützen eine Geres-Lösung, St. Gallen das VRSG-Angebot, Luzern eine Eigenentwicklung und Zürich und Zug kennen gar keine zentralen Register. «Diese Vorgehensweise hat Inseln geschaffen und es gibt keine zentrale Stelle auf Bundesebene, welche die Umsetzung des E-Umzugs forciert.
Da die Komplexität des Vorhabens oft unterschätzt wird, gibt es auch nach sieben Jahren Arbeit an diesem Projekt noch keine schweizweite Lösung», sagte Marcel Alder. 2013 wird es zumindest unter denjenigen Gemeinden, welche mit der VRSG-Software arbeiten, möglich sein, die Prozedur elektronisch abzuwickeln. Den Bürger dürfte es jedoch kaum interessieren, welcher Software-Firma seine Kommune ihr Vertrauen schenkt. (aes)