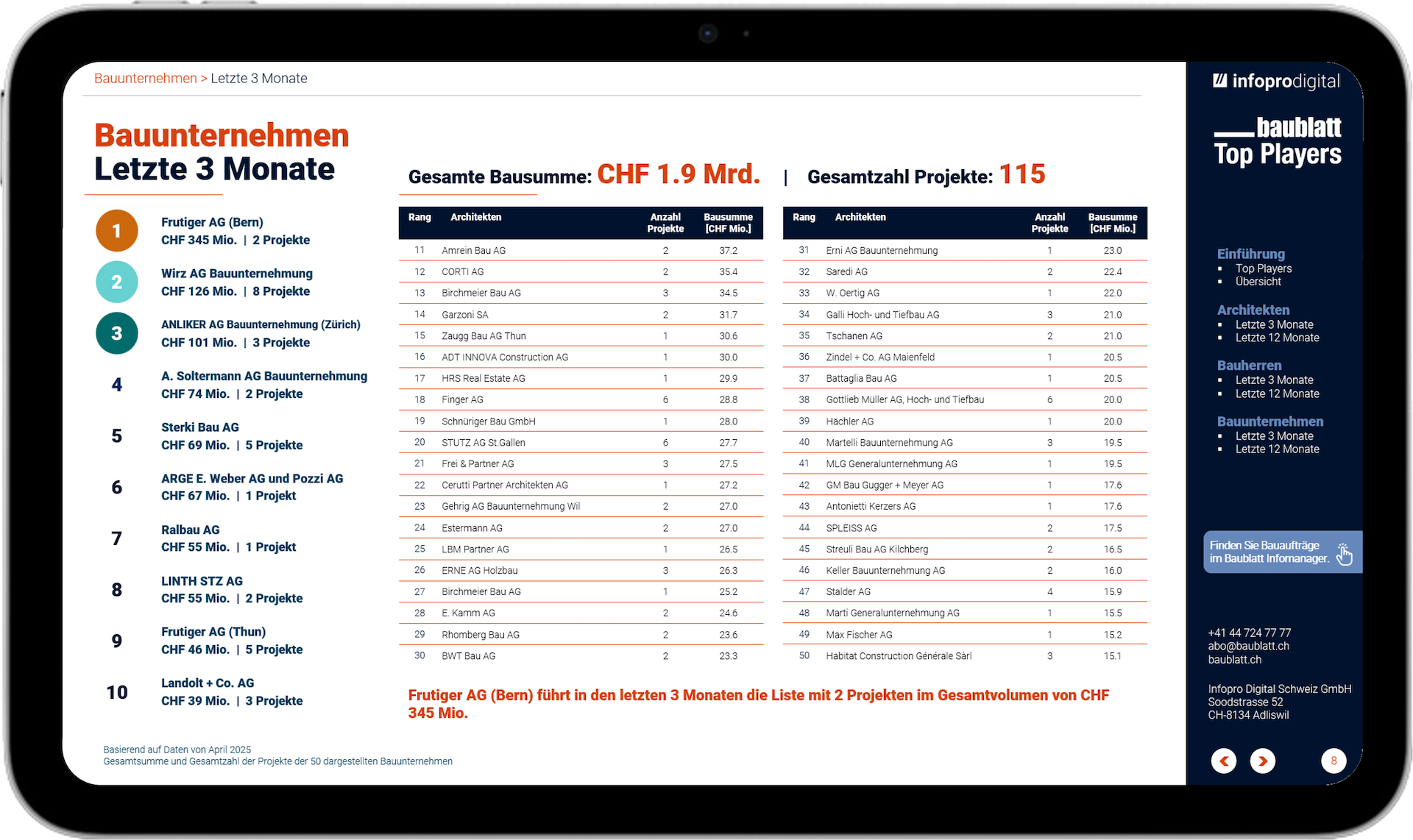Gemeinde-Apps: Es geht noch digitaler
Die Vorstellung einer eigenen App hat ihren Reiz. Angesichts der Kosten und des Wartungsaufwands sollte sie aber mehr als eine Spielerei sein. Was müssen Städte und Gemeinden wissen, bevor sie ihr Angebot ausbauen und sich auf einen Hersteller einlassen?

Quelle: Nadine Siegle
Bunt und vielfältig: Die Apps, welche immer mehr Gemeinden, Regionen und Kantone für die Bevölkerung anbieten, kommen sehr unterschiedlich daher - sowohl im Aussehen als auch in der Anwendung.
Als die ersten Geschäfte diesen
Frühling nach dem Lockdown wieder öffnen durften, rief die Gemeindeverwaltung
Adelboden BE die Bevölkerung unter anderem per App dazu auf, das lokale Gewerbe
zu unterstützen. Einen Monat später informierte die Stadt St. Gallen in ihrer
App, dass der Botanische Garten unter Einhaltung des entsprechenden
Schutzkonzepts wiedereröffnet werden kann. Und in Biel erfuhren die Einwohner
via Smartphone-Applikation, dass der Stadtrat einer Covid-19-Solidaritätsaktion
mit Gutscheinen für die Bevölkerung zugestimmt hat. In Adelboden und St. Gallen
beinhaltet die jeweilige App auch eine Stadtmelder-Funktion, mit der
Beanstandungen oder Lob direkt bei der Verwaltung deponiert werden können - mit
Foto und genauen Standortinformationen.
Starke Zunahme seit 2015
Ein Blick in die gängigen App Stores zeigt: Täglich
erscheinen neue Apps auf dem Markt. Ob Spiele, Wettervorhersagen, Werkzeuge für
den Alltag, Bankdienstleistungen oder Nachrichten, es ist für jeden
Smartphone-User etwas dabei. Dieser Trend macht auch vor Behörden keinen Halt.
Online-Services auf der Gemeinde-Webseite sind zwar schon seit längerem auf dem
Vormarsch. Nun setzen Schweizer Städte und Gemeinden aber vermehrt auf eine
Kombination mit einer Handy-App.
Diese Tendenz bestätigt das «Swiss Mobile Government App
Monitoring», eine Untersuchung der Behörden-App-Landschaft, die erstmals im
Jahr 2015 und Anfang 2020 erneut durchgeführt wurde. «Das Monitoring zeigt,
dass heute deutlich mehr Behörden-Apps auf dem Markt sind. Darunter sind viele
Angebote des Bundes», erklärt Matthias Stürmer, Leiter der Forschungsstelle
Digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern. Auch die Zahl der Apps von
kantonalen Stellen habe sich im Vergleich zu 2015 verdoppelt.
Unmittelbar und personalisiert
Die Erklärung dieses Wachstums liegt nahe: «Es gibt eine
immer höhere Durchdringung der Mobile Devices, in allen Lebensbereichen», so
Stürmer. Mehr als die Hälfte der globalen Internetnutzung findet heute mit
mobilen Geräten statt, in einzelnen Bereichen sind es sogar über 90 Prozent.
Neun von zehn Schweizern besitzen heute ein Smartphone. «Dieses hat man immer
bei sich, auch ausserhalb der Bürozeiten, abends auf dem Sofa oder im Bett.» Es
erstaunt also nicht, dass immer mehr Dienstleistungen über das Handy zur
Verfügung stehen und rege genutzt werden.
Für viele Angebote reicht grundsätzlich auch eine Webseite,
eine App ist dafür nicht zwingend notwendig. Wer Toilettenpapier bei der Migros
bestellen will oder einen Strafregisterauszug bei der Gemeinde beantragen
möchte, kann das problemlos über eine gewöhnliche Internetseite tun. Doch
Applikationen bieten verglichen mit normalen Webseiten mehr Funktionen: «In
einem Handy sind etliche Zusatzinformationen hinterlegt und abrufbar. Auch mit
Sensoren oder der Kamera bieten sich viel mehr Möglichkeiten», ist Stürmer
überzeugt. Ebenso wenn es um unmittelbare Benachrichtigungen geht: Über
Push-Nachrichten könnten zum Beispiel dringliche Warnmeldungen an die
Bevölkerung erfolgen, etwa eine Virus-Warnung. Zudem sei der User
identifizierbar, wenn die App ein Login verlangt. «So kann man auch
personalisierte Informationen übermitteln.»
Auch für Kleinere geeignet
Dass diese Entwicklung nicht nur etwas für die grossen, smarten Städte ist, sondern auch kleineren Gemeinden Vorteile bringen kann, zeigt Adelboden im Berner Oberland: Die Gemeinde mit rund 3300 Einwohnern hat Ende 2019 ein App-Angebot lanciert. «Über die App können wir die Bevölkerung sehr schnell informieren. Das Handy ist ja heute nicht mehr wegzudenken und Push-Nachrichten liest man als Nutzer unmittelbar», erklärt Mara Mazzarella, stellvertretende Gemeindeschreiberin von Adelboden. Dies sei etwa bei kurzfristigen Strassensperrungen sehr nützlich und viel effizienter, als wenn man es beispielsweise in einem Gemeinde-Anzeiger publiziere. Mazzarella ist es auch, die die News und andere Informationen jeweils in die App lädt.

Quelle: Olivier Bruchez, Flickr (CC BY-SA 2.0)
Nicht nur grosse Städte befassen sich mit App-Angeboten: Adelboden BE lancierte Ende 2019 eine Gemeinde-App und zeigt sich zufrieden mit den ersten Erfahrungen und den steigenden Nutzerzahlen.
Von analog zu App?
Obwohl die öffentliche Hand vermehrt auf Apps setzt, sind
noch nicht viele Gemeinden so digital unterwegs wie Adelboden. Zum Zeitpunkt
des Monitorings Anfang dieses Jahres gab es in der Schweiz 334 Behörden-Apps.
Vielerorts geht es vorerst um die Digitalisierung innerhalb der Verwaltung, die
Modernisierung der Webseite oder den Auf- und Ausbau von ersten
Online-Dienstleistungen. «Wenn ganz grundlegende Arbeitsschritte oder Angebote
noch nicht digital sind, dann ist es noch zu früh. Eine App ist ein Luxus»,
betont Stürmer.
Eins nach dem anderen. Denn ganz so modern sind die Verwaltungen in der Schweiz noch nicht. «Ehrlicherweise haben Städte und Gemeinden auch bei den einfacheren digitalen Angeboten noch viel Luft nach oben.» Damit meint Stürmer nicht nur kleinere Gemeinden, für die diese Entwicklung herausfordernd sein kann. Auch einige grössere Städte hätten noch Verbesserungspotenzial. Er empfiehlt deshalb, bereits beim Ausbau der Onlinedienste vor allem dort genauer hinzuschauen, wo wiederkehrende Prozesse durch eine App erleichtert werden könnten.
”Ehrlicherweise haben Städte und Gemeinden auch bei den einfacheren digitalen Angeboten noch viel Luft nach oben.
Matthias Stürmer, Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern
Matthias Stürmer, Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern
Kamera oder Sensoren nutzen
Sind Online-Dienstleistungen einmal etabliert und die Verwaltung digitalisiert, könnte die Vorstellung einer App an Reiz gewinnen. Doch hier warnt Stürmer: Es ginge nicht darum, eine Applikation programmieren zu lassen, nur um eine zu haben. «Wer lediglich eine bestehende Webseite und die dort verfügbaren Online-Dienste in die Form einer App presst, hat keine Vorteile daraus.» Es braucht keine zusätzliche Software, um ein Online-Formular auszufüllen. Das kann der Bürger nach seinem Gusto auf dem Computer oder auch am Handy im Browser tun. Vielmehr könnten mit einer App erweiterte Angebote entstehen und die Zusatzfunktionen des Mobiltelefons einbezogen werden. Dies ist etwa bei den Schadenmelder-Apps der Fall, indem die GPS-Lokalisierung und die Kamerafunktion des Smartphones einbezogen werden.
In diesen Prozess muss die meiste Denkarbeit fliessen: Was möchte man mit der App erreichen? Was soll sie dem Nutzer bringen? «Behörden, die eine eigene App möchten, müssen einen gezielten Mehrwert anstreben. Ansonsten lohnt sich der Aufwand nicht», rät Stürmer. Wo er besondere Vorteile verortet: In Behördengängen mit mehreren Verfahrensschritten und Rückmeldungen, wie etwa bei einem Baugesuch. «Wenn man auf dem Handy nach der Eingabe den Status mitverfolgen kann und allenfalls weitere Interaktionen stattfinden können, ist eine App sehr nützlich.»
Alles hat seinen Preis
Generiert die Behörden-App schliesslich einen Mehrwert für den Bürger und gleichzeitig vielleicht sogar für die Verwaltungsmitarbeitenden, hat die Gemeinde ihr Ziel erreicht. Kosten hat sie damit aber höchstwahrscheinlich keine gespart. Abhängig von der Komplexität der Funktionen variiert der Preis stark. «Es gibt viele vorgefertigte Lösungen für Gemeinden, zum Beispiel von Anbietern wie Anthrazit oder ‹i-web›. Diese sind schnell aufgesetzt und enthalten bereits viele der Funktionen, die eine Gemeinde braucht», weiss Stürmer. So könnten 5000 bis 10000 Franken an Beschaffungskosten möglicherweise ausreichen. Bei spezielleren Anforderungen könne der Preis aber auf 50000 bis 100000 Franken steigen. «Man muss sich bewusst sein: Kostengünstig ist die Sache nicht. Dafür tut man etwas für die Standortattraktivität.»
Die Initialkosten erzählen aber selten die ganze Geschichte.
Unterhalt und Wartung sind unabdingbar, damit ein System langfristig voll funktionstüchtig
bleibt. Ungefähr 20 Prozent der Initialkosten sollten jährlich für die Wartung
einer Applikation budgetiert werden, sagt Stürmer. Zwar sind auch bei der
bereits vorhandenen Webseite Updates nötig, doch im App-Bereich kommt die
schnelle technologische Entwicklung noch viel stärker zur Geltung. «Der
Wartungsaufwand ist bei Apps deutlich höher als bei einer gewöhnlichen
Webseite. Es muss regelmässig in die Sicherheit investiert werden, da sich die
Sicherheitsanforderungen laufend verändern.» Das Mass an Eigenleistung
respektive Aufwand hängt hier von der gewählten Lösung ab. Das Angebot der
Gemeinde Adelboden beispielsweise basiert auf der Applikation «My Local
Services» der Post und läuft in einem Abo-Modell, dessen jährlicher Preis sich
anhand der Einwohnerzahl berechnet.

Quelle: Nadine Siegle
Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt: Gemeinde-Apps eignen sich auch für die Organisation von Nachbarschaftshilfe oder dringliche Warnungen, wie etwa eine Virus-Warnung.
App Stores machen Regeln
Nicht zu vergessen ist, was im Hintergrund einer App
passiert. Sie selbst sei nur die Spitze des Eisbergs, so Stürmer. Im ersten
Moment denke man an das, was der Nutzer sieht, das Front-End. Dahinter steht
aber ein ganzes System, inklusive einer Art Cockpit, einer
Administrationsoberfläche. «Das Front-End hat heute eine sehr tiefe
Halbwertszeit. Nach wenigen Jahren muss man es ohnehin überarbeiten. Das
Back-End hingegen sollte so aufgesetzt sein, dass es auch langfristig gewartet
werden kann.»
Bei der Wartung kommt die «Fremdbestimmung» als weiterer
Faktor hinzu. Stürmer meint damit vor allem Google und Apple, die
App-Store-Betreiber, welche die Spielregeln vorgeben. In den letzten Jahren
haben sich sowohl Hard- als auch Software stark verändert. «Die Store-Betreiber
prüfen die Qualität der Apps und geben die Standards vor. Bestehen sie die
regelmässige Überprüfung nicht, sind sie raus.»
Auch im Monitoring der Behörden-App-Landschaft zeigte sich, dass nicht alle gleich gut mit diesen Herausforderungen umgehen: Während zwischen 2015 und 2020 zwar viele neue Behörden-Applikationen hinzugekommen sind, ist rund ein Drittel von denen, die man 2015 noch herunterladen konnte, in den letzten fünf Jahren verschwunden.
Späterer Ausbau mitdenken
Vor dem Entscheid für eine vorgefertigte App oder eine individualisierte Lösung müssen also viele Eventualitäten einbezogen und abgewogen werden. Dabei stellt sich auch die Frage, wie flexibel die Software sein soll. Vielleicht werden zunächst wenige Dienstleistungen per App angeboten. Doch möchte man das Angebot künftig ausbauen? Sollen später Funktionen hinzukommen, die bereits zu Beginn mitgedacht werden sollten? «Wenn die Erfahrung und die nötigen Kenntnisse fehlen, macht es Sinn, sich hierzu beraten zu lassen.» Für Stürmer muss in einer Gemeinde zudem nicht das ganze technische Know-how vorhanden sein, um eigene Apps aufzubauen oder zu betreiben. Das können Externe übernehmen. «Man braucht aber etwas Grundwissen über die Funktionen und muss im Bilde darüber sein, wo die eigenen Daten liegen», betont er.
Wie in der Ehe
Nicht zuletzt können übermässige Abhängigkeiten so bereits
in einem frühen Stadium verhindert oder zumindest bewusst eingegangen werden.
«Man muss immer an einen Exit denken», sagt Stürmer. Man begebe sich in ein
Abhängigkeitsverhältnis und verbandle sich eng mit einem App-Hersteller. Er
vergleicht die Zusammenarbeit mit einer Hochzeit, bei der mit einem Ehevertrag
bereits an potenzielle künftige Streitigkeiten gedacht wird. «Man sollte sich
gut überlegen, was passiert, wenn man sich trennt. Wem gehören die Nutzerdaten?
Und die hinterlegten Informationen? Diese Fragen sind essenziell.»
Es könne zudem Sinn machen, den Quellcode zu verlangen, um
die App später selbständig weiterzubetreiben. Stürmer ist sich aber bewusst,
dass viele Anbieter nicht mit Open-Source-Software arbeiten. Deshalb empfiehlt
er, schon zu Beginn Vereinbarungen über einen künftigen Datenexport zu treffen.
«Man speist über die Zeit derart viele Informationen in das System. Falls man
den Anbieter wechseln möchte, muss dies möglich sein.»
Trotz der vielen Fragen und Herausforderungen, die mit dem Entscheid für eine App auftauchen können, sieht Stürmer grosses App-Potenzial in Gemeinden und Städten. Ob die heute verfügbaren Apps sich bis zu einem nächsten Monitoring im Jahr 2025 halten, wird sich zeigen. In Adelboden ist die erste Bilanz zumindest positiv. «Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind sehr gut. Und die Nutzerzahlen steigen weiter», bestätigt die stellvertretende Gemeindeschreiberin.