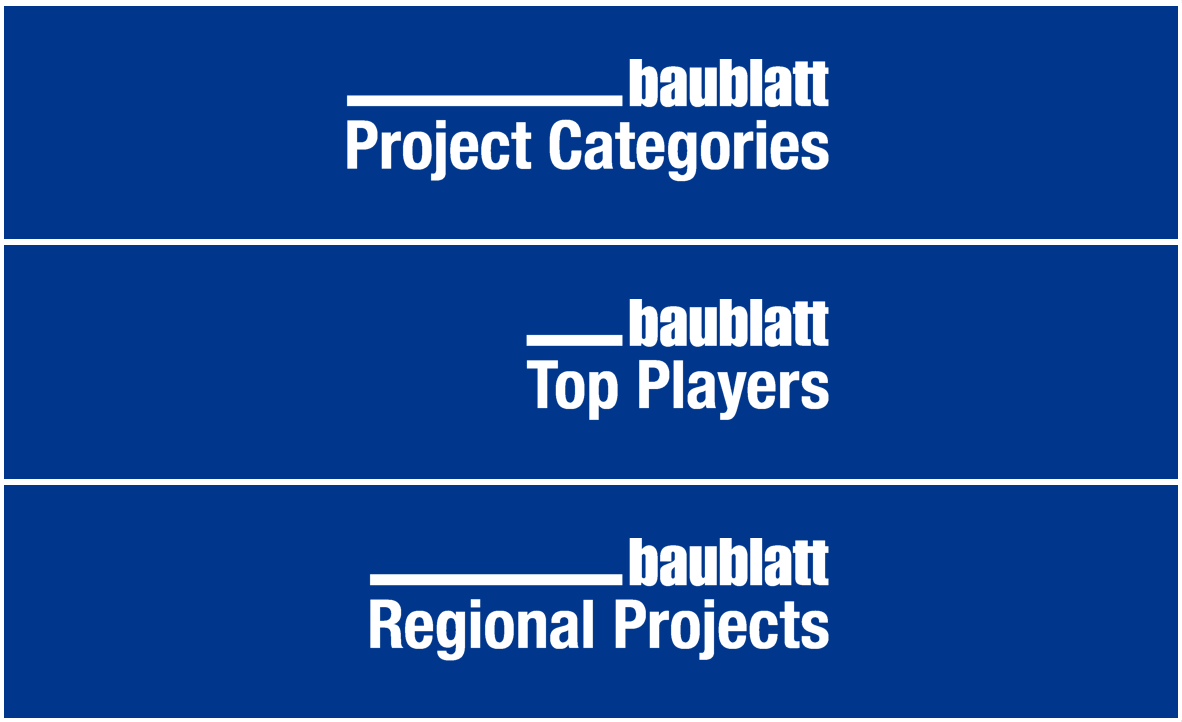Städtebau: Wie Verkehrsachsen zu Flanierzonen werden
Strassenachsen durch Siedlungsgebiete lassen sich aufwerten und in Boulevards verwandeln. Dabei handelt es sich um komplexe Projekte der Stadtentwicklung. Doch auch kleine bauliche Eingriffe oder Bepflanzungen können grosse Wirkung entfalten. Ein Buch zeigt, worauf zu achten ist.

Quelle: Institut Urban Landscape, ZHAW
Mit Baumreihen entlang von Strassen und hinter den Häuserzeilen lassen sich Vernetzungskorridore schaffen, sodass wirksame Kaltluftströme entstehen können.
In den Ferien sind Stadtwanderungen auch Entdeckungstouren. Entlang von Boulevards reihen sich Läden an Restaurants mit lokalen Spezialitäten. Eine Gasse führt unverhofft zu einem Sandplatz mit altem Baumbestand, schattige Bühne fürs Boccia- oder Boule-Spiel. Es sind Orte des Verweilens, animiert wohl auch vom neusten Tratsch. Mit der Forderung nach Innenverdichtung geraten Ortsdurchfahrten auch hierzulande vermehrt in den Fokus von Planerinnen und Planern. Es ist das Bestreben, das schnelle Wachstum in Bahnen zu lenken nach der dynamischen Siedlungsentwicklung der letzten Jahrzehnte.
Strassen bilden Stadtachsen, die ins Zentrum führen und gesäumt sind von historisch gewachsenem Baubestand und neuen Gebäuden. Doch die Einfallachsen sind oft geprägt von heterogenen Baustrukturen und Gebäuden für Mischnutzungen mit Wohn- und Büroflächen oder Werk-stätten. Sie erzeugen durch ihre Vielschichtigkeit und räumlichen Qualitäten zwar erlebnisreiche Nachbarschaften. Oftmals fehlen jedoch öffentliche Räume ohne Konsumzwang oder Begegnungszonen zum Verweilen.
Hoch- und Tiefbau strikt getrennt
Doch bei Ortsdurchfahrten und Stadtachsen handelt es sich oft um Ensembles von öffentlichen und privaten Aussenräumen sowie Gebäuden und Vorzonen. Zudem ist die Planung entlang von Strassen meistens strikt aufgeteilt auf den Tief- und den Hochbau. Einerseits fällt die Verkehrsplanung im Rahmen von Strassenbauprojekten in den Zuständigkeitsbereich von Tiefbauämtern, während Hochbauämter andererseits anhand der jeweiligen Bau- und Nutzungsplanung für die angrenzenden Bauprojekte bestimmend sind. Eine frühzeitige auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abgestimmte Koordination beider Aspekte findet bei diesem Vorgehen nicht in gebührendem Ausmass statt. Dieser Meinung sind die Autorin Regula Iseli sowie die Autoren Peter Jenni und Andreas Jud. Und sie präsentieren im Buch «Städtebau beginnt an der Strasse» Ansätze für eine andere Herangehensweise.
Denn der Klimawandel stellt zusätzliche Anforderungen an den Städtebau und die Siedlungsentwicklung. Im Buch sind konkrete Beispiele beschrieben, wie sich eine Quartierstrasse unter Einbezug von Bewohnerinnen und Bewohnern von Quartieren aufwerten lässt. Bei der Neugestaltung der Kantonsstrasse in Horw LU beispielsweise wurden private Grundeigentümer einbezogen. Auf Grundlage eines Gesamtkonzepts und der Festlegung der Baulinien führten Verhandlungen über Landabtretungs- und Dienstbarkeitsverträge zur Schaffung öffentlich nutzbarer Räume. Dadurch konnten durchgehende Streifen mit öffentlichem Fuss- und Fahrwegrecht geplant werden.
Nutzungsoffene Erdgeschosse
Ortsdurchfahrten sind oft geprägt von historisch gewachsenen Strukturen. Die Autorin und Autoren plädieren dafür, dass aus Strassen eigentliche Stadträume oder wohnliche Quartiere geschaffen werden. Dazu präsentieren sie im Buch räumliche Qualitätsmerkmale, welche als Basis dienen können für bauliche Massnahmen. Eines dieser Merkmale betrifft die Wahrnehmung des öffentlichen Raums, sodass mit diesem Ansatz die Nutzung von Strassenräumen neu gedacht werden kann. Denn lange galt es, den motorisierten Individualverkehr möglichst effizient zu organisieren. Ein kurzer geschichtlicher Abriss zeigt, dass ursprünglich mit grossen Verkehrsprojekten die Zentren der Städte mit Schnellstrassen hätten erschlossen werden sollen wie dem sogenannten «Ypsilon» in Zürich. Doch Verkehrsinfrastrukturen können als Lebensraum vielfältig nutzbar gemacht werden.

Quelle: Peter Jenni
Das Economist Building von Alison und Peter Smithson in London ist ein Beispiel hoher Durchlässigkeit zwischen der St. James Street und dem umliegenden Quartier.
In diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Frage zu klären, welche Raumangebote Erdgeschosse bieten sollen. Denn bei Gebäuden entlang von Hauptverkehrsachsen eignen sich Erdgeschosse aufgrund hoher Personenfrequenzen in aller Regel für publikumsorientierte Nutzungen wie Verkaufs- und Arbeitsräume, Treffpunkte oder gastronomische Angebote. Entstehen sollen aber auch Quartiere der kurzen Wege, in denen sich kleinere Einkäufe im Laden gleich um die Ecke tätigen lassen. Bei der Entwicklung von Quartieren können positive Rückkopplungseffekte eine wichtige Rolle spielen, um Veränderungen in Gang zu bringen. Gleichwohl gilt es, die Folgen negativer Rückkopplungen zu beachten und darauf zu reagieren. Denn beispielsweise ist rund ein Drittel des Verkehrs in Schweizer Städten auf homogene Wohn- und Arbeitsgebiete zurückzuführen, die über zu wenig Versorgungs- und Freizeitangebote verfügen. Das Beispiel verweist auf weitere Qualitätskriterien von Quartier- und Freiraumstrukturen. Die Ökologie und Mobilität gehören dazu – und das Angebot an Wohnungen.
Doch die Autorin und die Autoren belassen es nicht bei theoretischen Erwägungen über die Transformation von Ortsdurchfahrten zu aufgewerteten Stadträumen. Denn Gemeinden haben diesbezüglich schon einiges geleistet. Weiterentwicklungen von Strassenräumen erfordern umfassende Konzepte mit unterschiedlichen Stossrichtungen, um den im Buch definierten Qualitätskriterien gerecht zu werden. Für Gemeinden handelt es sich um komplexe Vorhaben, denn Stadtentwicklungen vollziehen sich mit hoher Dynamik, etwa indem neben Bestandsbauten neue Gebäude hochgezogen werden.
Durchlässige Bebauung in Köniz
Bei einem der Projekte ging es um die Sanierung und Umgestaltung der Schwarzenburgstrasse sowie des Zentrums von der Stadtberner Vorortsgemeinde Köniz. Doch die umfassenden baulichen Eingriffe waren im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen auszuführen. Dabei sind die spezifischen Eigenheiten kantonaler und kommunaler Planungs- und Baurichtlinien zu berücksichtigen. Beispielsweise können laut kantonalbernischem Baugesetz Teile von Bauzonen, wo Neubauten dem Bestand besonders angepasst werden sollen oder eine rücksichtsvolle Ortsentwicklung angezeigt ist wie in Dorfkernen, als Zonen mit Planungspflicht (ZPP) bezeichnet werden, und zwar wenn es nicht möglich ist, die nötigen Vorschriften in der Grundordnung zu erlassen. Diese ZPP bieten wie Bauvorschriften Gelegenheit, spezifische bauliche und räumliche Entwicklungen zu bestimmen. Aus dem längeren Planungsprozess liess sich schliesslich ein behördenverbindlicher Strukturplan ableiten, der für die nachfolgenden Schritte wegleitend war. Ziel war die Schaffung einer offenen, durchlässigen Bebauungsstruktur.

Quelle: Institut Urban Landscape, ZHAW
Auf der ehemals stark befahrenen Via San Gottardo in Balerna TI wurde Platz geschaffen für den Fuss- und Veloverkehr sowie für Begegnungsorte, doch fehlen Grünbereiche.
Stadtboulevard in Dietikon
Ein anderes Beispiel betrifft die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Dietikon ZH. Wie so oft kommt der Anstoss für städtebauliche Optimierungen von der Realisierung grossräumiger Verkehrsprojekte. In Dietikon waren Planung und Bau der Limmattalbahn Anlass für Justierungen bei der Siedlungsentwicklung. Ziel der Gemeinde war es, die Verkehrsachse zu einem eigentlichen Stadtboulevard aufzuwerten. Bei einem Auswahlverfahren erhielt das Atelier für Städtebau Van de Wetering 2015 den Auftrag für die Ausarbeitung des Leitbildes sowie der Dossier «Erdgeschoss» und «Hochhauskonzept». Das Leitbild bezweckt die gezielte Ver-dichtung und Aufwertung entlang der Verkehrsachse. Es dient als Basis für die Ortsplanung, die Entwicklung der Stadtachse und Beurteilungen von privaten Projekten beidseits des Stadtboulevards.
Auch in Balerna TI wurde vor Jahren die Ortsdurchfahrt umgestaltet. Die raumsparenden Verkehrslösungen und Tempo 30 brachten zwar Vorteile für die Koexistenz unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer, doch fehlen Grünbereiche und Schatten spendende Bäume sowie versickerungsoffene Böden. Auch andernorts entstehen stellenweise Hitzeinseln, wo an heissen Sommertagen ein Aufenthalt eher vermieden wird. Mit minimalen Eingriffen, etwa mit einer optimierten Bepflanzung, liesse sich die Lebensqualität von Quartieren verbessern.
Wirkung kleiner Grünflächen
Neben komplexen städtebaulichen Projekten finden im Buch auch kleine Interventionen Erwähnung wie die Aktion «mein Baum dein Baum». Die Initiative in der Stadt Basel hatte zum Ziel, das ungenutzte Potenzial von Vorgärten, also die schmalen Flächen zwischen Gebäudezeilen und Gehsteig, unter Einbezug der Anwohnerschaft mit Bäumen zu bepflanzen. Ein Fachteam bot Unterstützung bei der Wahl geeigneter Baumarten und begleitete die Aktion während zweier Jahre mit Tipps zur Pflanzenpflege. Vor den einzelnen Gebäuden bildeten die Bepflanzungen kleine Eingriffe, doch landschaftsarchitektonisch entfaltete das Engagement im gesamten Quartier über die eigene Garten-fläche hinaus Wirkung.
Für die Autoren sind Begrünungen von Stadtachsen in einem grösseren Zusammenhang zu sehen mit dem Zweck, in Quartieren ökologische Vernetzungskorridore zu schaffen, indem hinter den Häuserzeilen von Ortsdurchfahrten weitere Baumreihen gepflanzt werden. Es sind Verbindungselemente, die an heissen Sommertagen Voraussetzungen dafür schaffen, dass wirksame Kaltluftströme entstehen können. Als Beispiel für eine gelungene Vernetzung und einen positiven Effekt auf das Stadtklima wird ein Quartier in Brüttisellen erwähnt oder die Gutstrasse in Zürich. Die Umsetzung einer ökologischen Vernetzung ist auch an der Wülflingerstrasse in Winterthur gelungen. Insgesamt wird im Buch der ökologische Wert von Strassenräumen auf öffentlichem Grund aber noch als zu bescheiden beurteilt.
Mehr als alle Individualansprüche
Das Buch spannt in einem Kapitel geschichtlich den Bogen von den Bauer-dörfern, wo über lange Zeit Strassen zugleich Marktplätze waren, über das Aufkommen des motorisierten Privatverkehrs bis hin zu geplanten Schnellstrassen in die Stadtzentren. Aufschlussreich ist der Vergleich von zwölf Strassenräumen und der Skizzierung möglicher Problemfelder bei städtebaulichen Interventionen. Wie sich die Stadtplanung neu justieren lassen könnte, ist Thema eines weiteren Kapitels. Dabei stellen sich Herausforderungen wie die Partizipation der Bevölkerung.

Quelle: Institut Urban Landscape, ZHAW
Mehr Platz im öffentlichen Raum für den Langsamverkehr. Dazu wurde in der Stadt Zürich die Badener Strasse umgestaltet.
Im Buch werden auf Basis der vorgestellten räumlichen Qualitätsmerkmale Lösungen für Umgestaltungen von Ortsdurchfahrten einer kritischen Würdigung unterzogen. Die beschriebenen Konzepte, die Planung sowie die Umsetzung können sowohl für Behörden als auch alle anderen beteiligten Parteien als Inspirationsquellen dienen. Von der Fachwelt als exemplarisch beurteilt werden die Städtebauprojekte in Dietikon und Köniz. Allgemeingültige Lösungen will das Buch nicht präsentieren, dafür war die Siedlungsentwicklung in Dörfern, Städten oder in den Kantonen zu verschieden. Doch findet sich bei städtebaulichen Projekten ein Konsens der unterschiedlichsten Interessen, dürften sowohl das Gemeinwesen als auch Private von einer optimalen Lösung langfristig in der Summe mehr profitieren im Vergleich dazu, wenn alle Beteiligten ihre Individualansprüche durchsetzen.