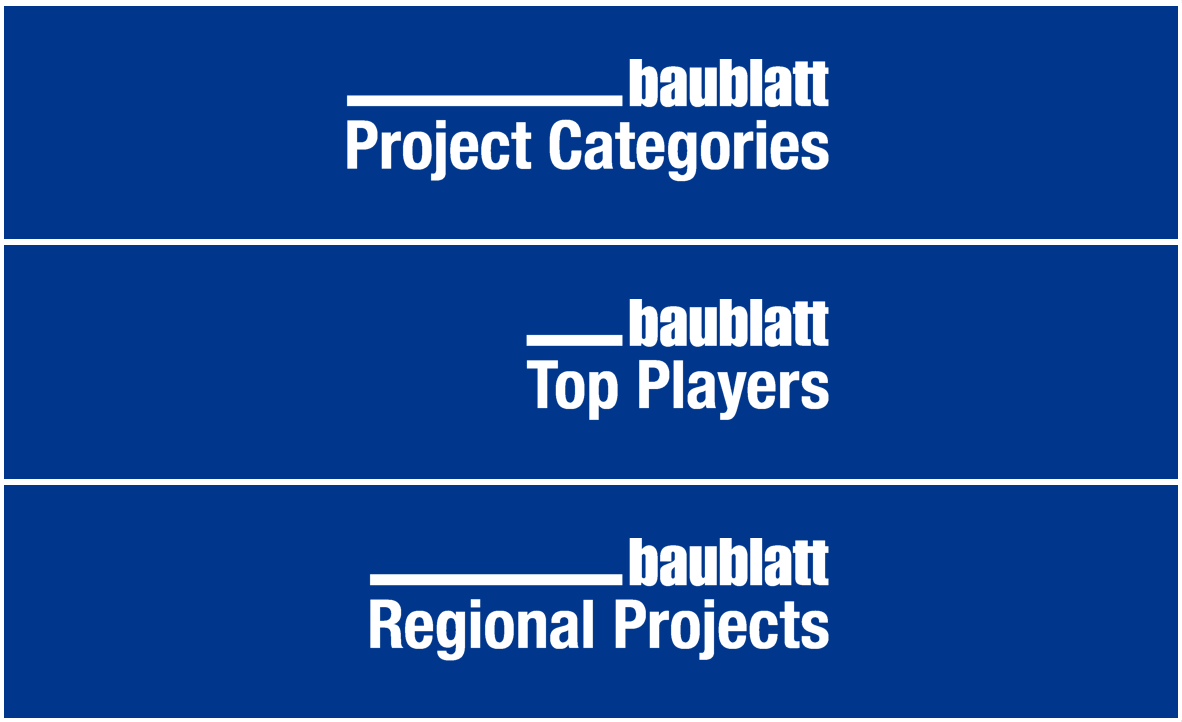Forschungsprojekt zu Klimaneutralität: Gemeinden initiieren Klimadialog
Die Schweiz soll bis 2050 klimaneutral werden. Eine wichtige Rolle kommt hierbei Gemeinden und Städten zu. 28 Gemeinden aus dem Berner Oberland haben zur Minderung der CO2-Emissionen einen Diskussionsprozess angestossen. Ein Ergebnis des Projekts ist die neu geschaffene Stelle eines Klimacoach: Die Person berät Bevölkerung und Behörden, wie Klimaschutz-Ideen realisiert werden können.

Quelle: Dres Hubacher
Klimacoach Alina von Allmen im Gespräch mit einem Landwirt.
Die Regionalkonferenz Oberland-Ost ist der Zusammenschluss
von 28 Gemeinden im östlichen Berner Oberland. Das Gebiet umfasst das obere
Aaretal von Innertkirchen bis Interlaken und schliesst die Jungfrauregion mit
ein. 2019 setzte sich die Regionalkonferenz das Ziel, eine klimaneutrale
Tourismusregion zu werden. Die Ausgangslage im Berner Oberland unterscheidet
sich nur unwesentlich von anderen Regionen in der Schweiz: Zwar hat es in der
Gegend noch recht viele Ölheizungen, zudem sind Landwirtschaft und Tourismus
wichtige Quellen von Treibhausgasen (ausgedrückt in CO2-Äquivalenten / CO2e),
aber mit Emissionen von 5,4 Tonnen CO2e pro Person und Jahr (für 2020) liegt die Region sogar leicht unter dem Durchschnitt des
Kantons Bern (5,84 Tonnen). Eine besondere Herausforderung für die Region ist allenfalls, dass die Dekarbonisierung der
Landwirtschaft nicht so leicht umsetzbar ist wie etwa im Gebäudebereich mit zum Beispiel einem Heizungsersatz und der Wärmedämmung oder im Verkehr mit der
Elektrifizierung.
Konkrete Handlungsansätze
Das Ziel der Klimaneutralität ist schnell beschlossen – aber
wie lässt es sich umsetzen? Um den Übergang zu einem klimafreundlichen Berner
Oberland voranzubringen, initiierte die Regionalkonferenz ein Projekt, das
konkrete Handlungsansätze hervorbringen sollte. «Viele einzelne Gemeinden
handeln bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien heute schon sehr
engagiert, doch ergänzend braucht es überkommunale Initiativen, denn viele
kleine Gemeinden können oftmals nicht auf die dazu notwendigen personellen und
finanziellen Ressourcen zugreifen», sagt Stefan Schweizer, Geschäftsführer der
Regionalkonferenz. Das Vorhaben wurde gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und
Energie des Kantons Bern und der Universität Bern (Zentrum für Nachhaltige
Entwicklung und Umwelt) durchgeführt. Gefördert wurde es von der 2019
gegründeten Wyss Academy for Nature und dem Bundesamt für Energie (BFE) im
Rahmen seines sozialwissenschaftlich ausgerichteten Forschungsprogramms
«Energie – Wirtschaft – Gesellschaft».
Gegenstand des vom BFE geförderten Teilprojekts war ein
«Transitions Management Prozess», also der Versuch, Aktionen anzustossen, die
den Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft unterstützen. Zu diesem Zweck
organisierte das Projektteam von Oktober 2020 bis Februar 2024 vier
Stakeholder-Workshops mit 34 bis 41 Vertreterinnen und Vertretern der
öffentlichen Hand, respektive der Bereiche Wohnen, Mobilität, Tourismus,
Energie, Holz- und Landwirtschaft sowie der Zivilgesellschaft. Zwischen dem
dritten und vierten Workshop wurden während eines Jahres erste
Klimaschutzprojekte angepackt. Der mehrjährige Diskussionsprozess wurde von
einem Monitoringteam der Universität Bern begleitet, das Interviews mit
Workshop-Teilnehmern und eine schriftliche Befragung der Bevölkerung
durchführte.
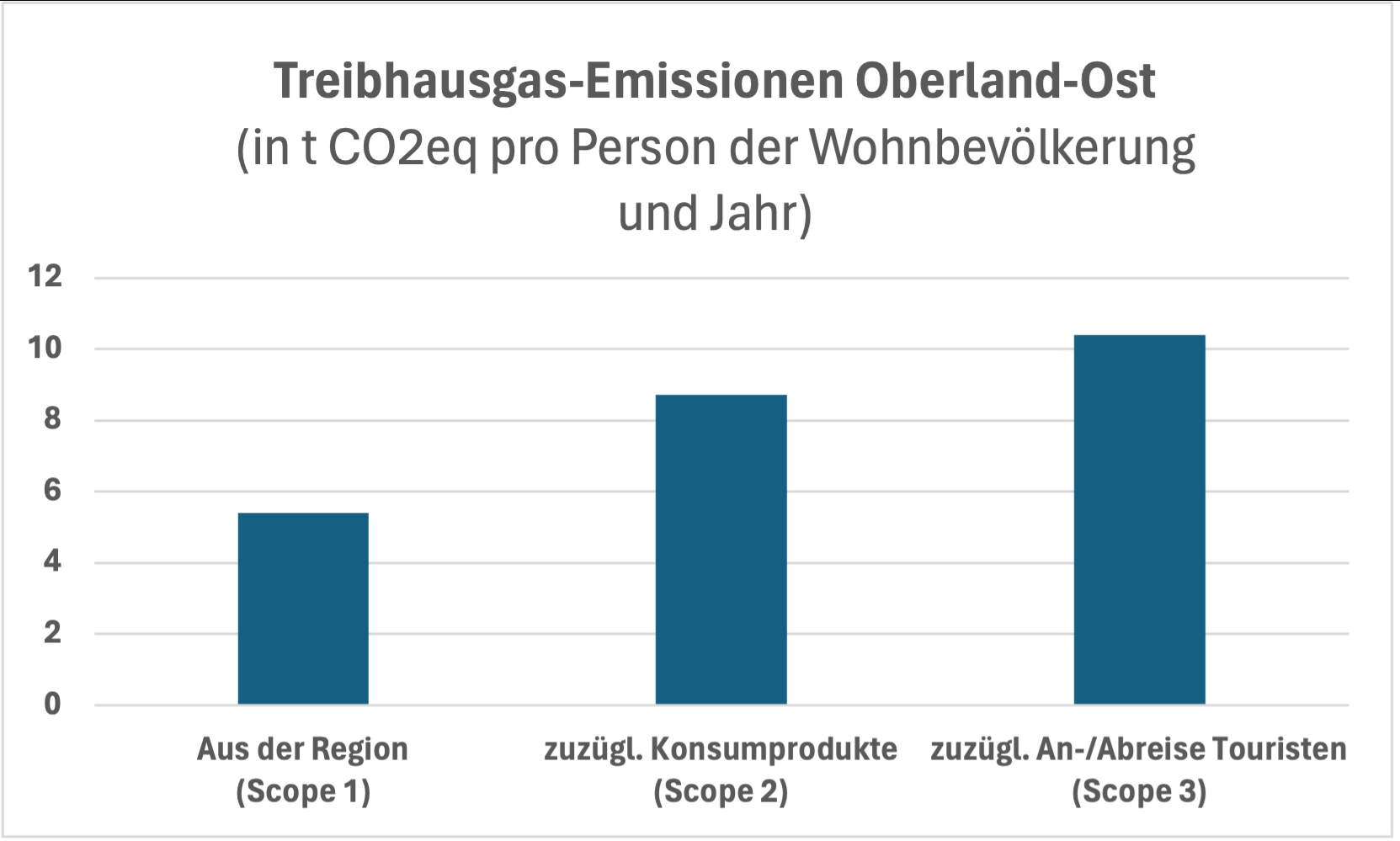
Quelle: Datenquelle: Ingenieur- und Beratungsbüro EBP/Grafik: B. Vogel
Beratung durch Klimacoach
Im Ergebnis lässt sich nicht ausmachen, welche Projekte
ausschliesslich durch diesen Diskussionsprozess angestossen wurden, und schon
gar nicht, wie viel Treibhausgas-Emissionen dadurch eingespart wurden.
Dokumentiert ist aber, dass nach einer anfänglichen Phase der Zurückhaltung
eine Reihe von Projekten initiiert wurde. «Inzwischen nahmen die eingereichten
und angegangenen Projektideen erfreulich zu», hält der Projektschlussbericht
von Mitte 2024 im Rückblick fest. Dazu gehören ein mit Solarstrom betriebenes
Touristenboot auf dem Brienzersee, die Machbarkeitsstudie für eine
Biogasanlage, die Treibhausgas-Bilanzierung für einen Bauernhof, oder ein für
Herbst 2024 geplantes Filmfestival zum Klimathema in Meiringen. Hinzu kommen
ein halbjährlich stattfindender Stammtisch für Tourismusexpertinnen und
-experten und eine zweitägige «Klimawerkstatt», bei der Privatpersonen
Klimaschutzideen zu konkreten Projekten entwickeln und anschliessend umsetzen
sollen.
Ferner entstand in den Workshops die Idee, unter dem Dach
der Regionalkonferenz die Stelle eines Klimacoach zu schaffen, der
interessierte Personen in Klimaschutzprojekten berät. Die zunächst auf zwei
Jahre befristete Stelle wird seit Dezember 2022 von der Agronomin Alina von
Allmen wahrgenommen. «Leider werden die bestehenden Angebote zu Energiethemen
und Klimaschutz noch wenig genutzt, weil sie entweder zu wenig bekannt sind
oder die Notwendigkeit nicht gesehen wird», sagt von Allmen zur Motivation ihrer
Tätigkeit. «Der wichtigste Faktor, dass Personen im Klimaschutz aktiv werden,
sind nicht nur Fakten, sondern Emotionen und dass man die Menschen dort abholt,
wo sie stehen, hier bei uns etwa bei der Verbundenheit zur Landschaft, zu
Bergen und Schnee.»

Quelle: IWB
Ein Transitions Management Prozess kann ein öffentliches Bewusstsein zugunsten des Klimaschutzes stärken, aber am Ende zählt der direktdemokratische Entscheid: Das Skigebiet Meiringen-Hasliberg gehört zum Gebiet der Regionalkonferenz Oberland-Ost. Hier plante der Basler Energieversorger IWB – unabhängig vom Transitions Management Prozess – eine alpine Solaranlage. Im Januar 2024 lehnte die lokale Gemeindeversammlung das Projekt ab.

Quelle: Brienz Tourismus
Über Umwege zum Ziel: Die Sportbahnen Axalp arbeiteten im Transitionsprojekt eine Idee aus, wie sie ihre Pistenfahrzeuge CO2-neutral betreiben können. Die Beschaffung steht noch aus, dafür haben sie mit einem Elektro-Shuttleboot am oberen Brienzersee ein klimafreundliches Sommerangebot geschaffen.
Andere Gemeinden interessiert
Das Projekt wird mit Unterstützung der Wyss Academy for
Nature und des Kantons Bern bis 2029 weitergeführt. Thomas Rosenberg vom Amt
für Umwelt und Energie des Kantons Bern wertet den gut dreijährigen
Stakeholder-Prozess im Berner Oberland als Erfolg: «Es ist gut möglich, dass
der Kanton Bern gewisse Elemente in Zukunft in ein Angebot für alle Gemeinden
übernimmt. Eine weitere Region hat bereits Interesse angekündigt», sagt er.
Stefan Schweizer, Geschäftsführer der Regionalkonferenz Oberland-Ost, sieht das
Transitionsprojekt ebenfalls als Inspiration für andere Schweizer Gemeinden:
«Ein Prozess mit regionalen Akteuren und Entscheidträgern stärkt das
gemeinsame Bewusstsein und Verständnis für dringend notwendige Massnahmen
gegen die weitere Klimaerwärmung. Der Prozess hilft zu erkennen, welche
regionalen Massnahmen sich aus eigener Kraft realisieren lassen, beispielsweise
durch Schaffung eines attraktiven öV-Angebots.»
Das Zentrum für Nachhaltige Entwicklung und Umwelt (CDE) der Universität Bern hat den Stakeholder-Prozess im Berner Oberland mit einem Monitoring begleitet und dabei versucht zu ermitteln, welche Faktoren dazu beitragen, dass Menschen zu neuen Aktivitäten zugunsten des Klimaschutzes motiviert werden können. «Entscheidend ist, dass der Prozess aus der Region heraus angestossen wird und idealerweise in einer gemeinsamen Übereinkunft – zum Beispiel einem Strategiepapier – verankert ist, das ihn legitimiert», sagt CDE-Wissenschaftlerin Stephanie Moser. Weitere Erfolgsfaktoren seien, dass die Teilnehmer der Workshops bewusst und ausgewogen ausgesucht werden und dass der Diskussionsprozess ergebnisoffen angelegt wird, Raum für Kreativität schafft und die Ergebnisse zurückspiegelt.
Der Schlussbericht zum Projekt «Lokale
Energie-Transitions-Experimente als Beitrag zur Transformation hin zu einer
klimaneutralen Gesellschaft – Pilotierung eines Transition Management Prozesses
im Berner Oberland» ist abrufbar unter: https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=47521
Das Ergebnis des Transformationsprozesses, die
Umsetzungsagenda zur Vision der Region Oberland-Ost, ist abrufbar unter www.oberland-ost.ch > Aufgaben > Klimaneutrale
Region.
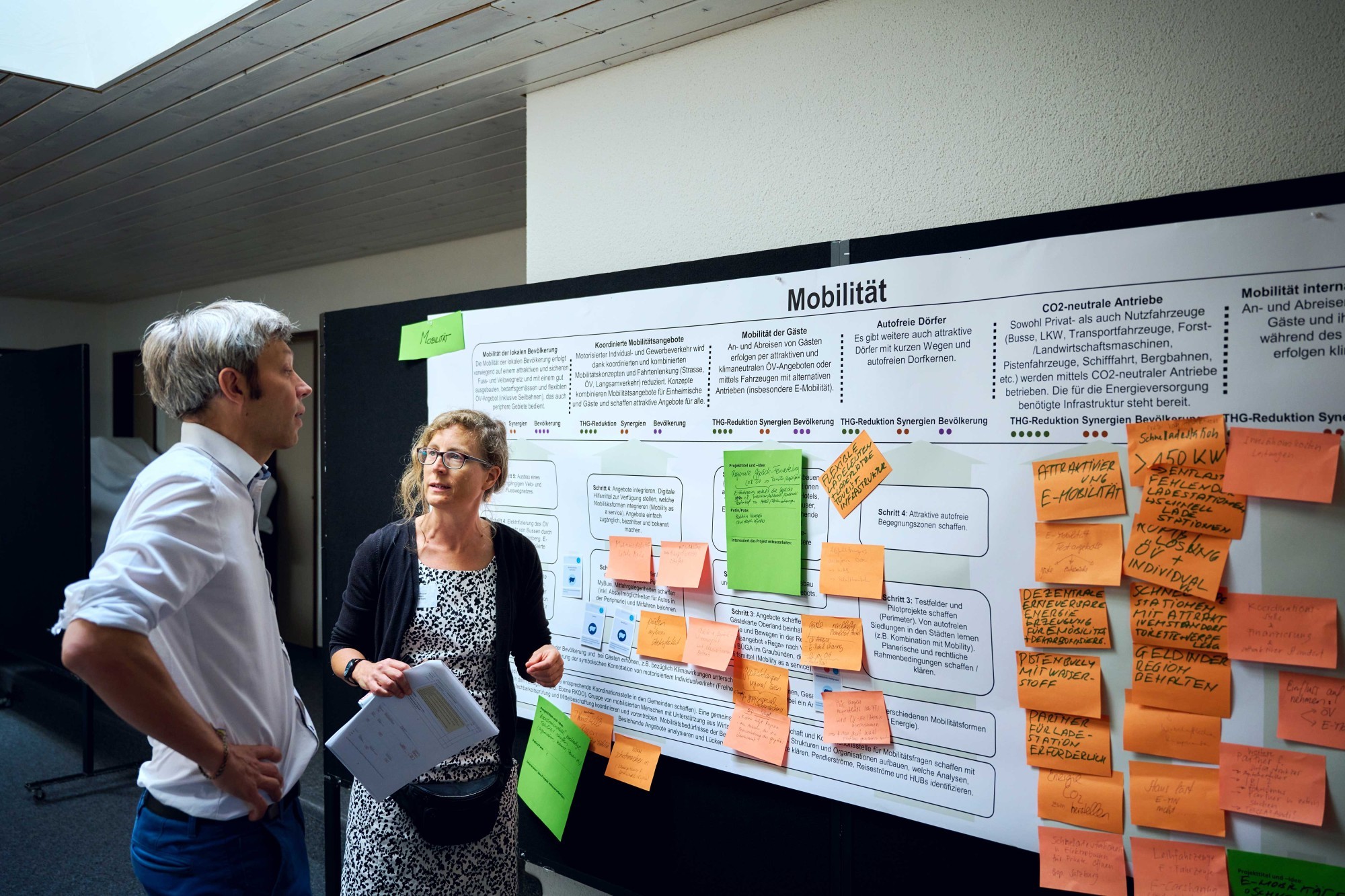
Quelle: Manu Friedrich
In vier Workshops wurden Ideen gesucht, um den Treibhausgas-Ausstoss in der Region zu senken.

Quelle: Manu Friedrich
Im dritten Stakeholder-Workshop kam ein Kartenset mit Klimaschutz-Ideen zum Einsatz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten dann zu bewerten, ob sich diese Ideen auf das Berner Oberland übertragen lassen.
Treibhausgas-Emissionen
Um den Treibhausgas-Ausstoss einer Region zu messen, gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Bezieht man alle Emissionen mit ein, die auf dem Gebiet der 28 Gemeinden in der Region Berner Oberland-Ost entstehen, und legt man diese Emissionen auf die in der Region lebende Wohnbevölkerung um, kommt man auf 5,4 Tonnen CO2e pro Person und Jahr. Eingeschlossen sind hier die Emissionen der Landwirtschaft und beispielsweise auch die touristischen Übernachtungen, nicht aber die Emissionen der in der Region verbrauchten Konsumgüter, die ausserhalb der Region produziert wurden. Rechnet man letztere mit ein, steigen die Emissionen pro Kopf und Jahr auf 8,7 Tonnen. Rechnet man die Emissionen dazu, die Touristinnen und Touristen während ihrer An- und Abreise verursachen, steigen die Emissionen auf 10,4 Tonnen pro Person und Jahr. Dieser hohe Wert erklärt sich aus dem Umstand, dass die Region Berner Oberland-Ost viel Tourismus hat, mit 48 000 Personen aber eine geringe Wohnbevölkerung. (bv)
Frühzeitige Beteiligung
Die Schweizer Bevölkerung ist auf kommunaler, kantonaler und
Bundesebene über verschiedene politische Instrumente in Entscheide zum
Klimaschutz eingebunden. Welchen Zusatznutzen versprechen Stakeholder-Prozesse
wie jener im Berner Oberland? Dazu die Einschätzung von CDE-Wissenschaftlerin
Stephanie Moser: «Unser Ansatz ergänzt die politischen Entscheidungsprozesse,
indem er interessierten Personen eine frühzeitige Beteiligung an
klimapolitischen Projekten und Entscheidungen ermöglicht und Eigeninitiative in
den Vordergrund rückt. Wenn wir die Menschen früher mitnehmen können, fördert
das ihr Engagement und ihre Identifikation mit Klimaschutzprojekten.»![]() (bv)
(bv)