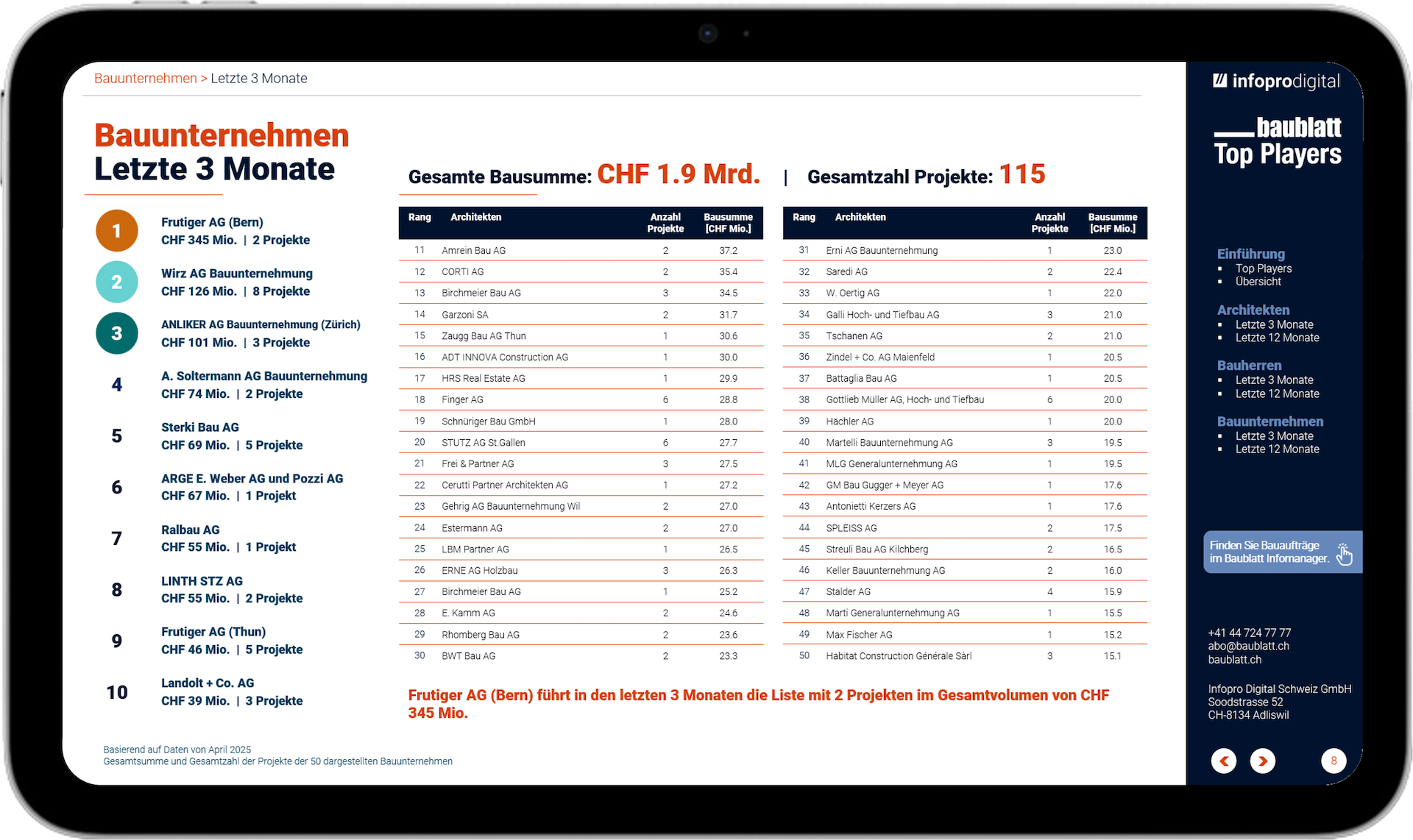Die Gemeindegrösse allein ist kein Fusionskriterium
Jede vierte Schweizer Gemeinde befasst sich zurzeit mehr oder weniger aktiv mit der Frage einer Fusion. Immer wieder wird im Rahmen von Fusionsabklärungen oder politischen Diskussionen die Frage nach der optimalen Grösse einer Gemeinde gestellt, und gleichzeitig auch die Frage, wie weit die Gemeindegrösse für einen Fusionsentscheid von Bedeutung ist. Nachfolgend soll aufgezeigt werden, wie komplex die Frage nach der «richtigen» Grösse einer Gemeinde ist. Dabei werden zahlreiche Fragen gestreift, die auch im Rahmen von Fusionsabklärungen untersucht werden müssen.
Kantonale Rahmenbedingungen
Die Aufgaben sowie die Grundzüge der Organisation und damit der Handlungsspielraum von Gemeinden werden in der Schweiz in überwiegendem Mass vom jeweiligen Kanton vorgegeben. Der Kanton bestimmt grundsätzlich das Aufgaben-Portfolio der Gemeinden; der Spielraum für selbst gewählte Gemeindeaufgaben ist daneben vergleichsweise klein. Einige Kantone übertragen den Gemeinden in bestimmten Bereichen die Zuständigkeiten abgestuft nach der Zahl der Einwohnenden. Dies ist im Kanton Bern beispielsweise hinsichtlich der ordentlichen Baubewilligungskompetenz der Fall. Der Kanton bestimmt auch die zulässigen Formen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) und der Auslagerung von Verwaltungsaufgaben auf private Träger. Letztlich bestimmen die kantonalen Vorschriften über den Finanzhaushalt der Gemeinden und über den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich den Handlungsspielraum der Gemeinden in entscheidendem Mass mit. Ein kantonsübergreifender Vergleich zwischen Gemeinden wird durch die unterschiedlichen kantonalen Rahmenbedingungen weitgehend verunmöglicht.
Betriebswirtschaftliche Sicht
Ausgehend vom Aufgabenportfolio der Gemeinden in einem bestimmten Kanton ist heute die Berechnung möglich, für welche Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner eine bestimmte staatliche Leistung aus betriebswirtschaftlicher Sicht optimal erbracht werden kann. Auf diese Weise wurde beispielsweise errechnet, dass eine Spitex-Organisation die Leistungen optimal erbringen kann, wenn ihr Einzugsgebiet rund 30 000 Bewohner umfasst. Voraussetzung ist allerdings, dass die Qualität der Leistung bestimmt ist, sei es aufgrund von fachlichen Vorgaben, sei es wegen der Bedürfnisse der Kunden. Gerade die Ansprüche der Bevölkerung an Gemeindedienstleistungen sind aber recht unterschiedlich und oft kulturell geprägt. Bei Gemeindeaufgaben, die auf spezifische Infrastrukturen angewiesen sind, können zudem die Grenzkosten, also die zusätzlichen Kosten für eine weitere Leistungseinheit, beim Überschreiten einer gewissen Anzahl zusätzlicher Leistungsbezüger sprunghaft ansteigen. Dies ist beispielsweise bei der Volksschule der Fall, wo einige wenige Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger für die Führung einer Klasse massgeblich sind und damit einen Schulhausneubau oder die Schliessung eines Schulhauses bewirken können. Weiter ist zu bedenken, dass die optimale Zahl der Leistungsbezüger für verschiedene Gemeindedienstleistungen unterschiedlich sein kann. Zuletzt stellt sich die Frage, ob eine betriebswirtschaftliche Optimierung nicht auch durch IKZ erreicht werden kann. Jüngere Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Skalenerträge bei Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnerinnen oder Einwohnern tendenziell eher wieder abnehmen.
Soziodemografische Sicht
Eine Gemeinde ist nicht nur ein Betrieb, sondern ein gesellschaftliches Subsystem – ein lebender Organismus mit einer bestimmten Geschichte und Kultur. Auf diesem Hintergrund stellt sich die Frage der optimalen Gemeindegrösse anders. Massgeblich ist, ob das System Gemeinde nachhaltig aus sich heraus funktionieren kann. Dies bedingt, dass die Bevölkerungsstruktur mittelfristig in etwa erhalten bleibt, sowohl zahlenmässig wie auch bezüglich der Altersstruktur. Probleme stellen diesbezüglich hohe Abwanderungsraten ebenso wie zu hohe Zuwachsraten. Ein Problem kann auch darin bestehen, die notwendigen ehrenamtlichen Gemeindebehörden nicht mehr besetzen zu können; ein Problem, das sich zunehmend in kleinen Gemeinden, aber nicht nur dort zeigt. Das Funktionieren einer Gemeinde bedingt ein relativ homogenes Kulturverständnis der gesamten Bevölkerung. Dies betrifft auch die politische Kultur. Es nützt beispielsweise wenig, wenn eine Gemeinde aus betrieblicher Sicht eine optimale Grösse aufweist, die notwendigen Führungsentscheide aber nicht rechtzeitig gefällt werden können, weil sich in der Exekutive Ortsteilvertretungen ständig gegenseitig blockieren. Aus soziodemografischer Sicht gilt es weiter zu bedenken, dass nicht in allen Gemeinden in gleichem Masse soziale und interkulturelle Integrationsaufgaben anfallen.
Geografisch-topografische Sicht
Die topografischen und geografischen Gegebenheiten, also die Lage einer Gemeinde, prägt deren Potenzial massgeblich. So kann die Topografie einer Gemeinde am Ende eines engen Bergtals dazu führen, dass die Frage nach einem Wachstum der Gemeinde – sei es durch Entwicklung, sei es durch Zusammenwachsen mit anderen Gemeinden – gar nicht sinnvoll gestellt werden kann. Die allgemeine geografische Lage bestimmt die Möglichkeiten der Raumentwicklung, der regionalen Zusammenarbeit sowie der regionalen Entwicklung mit. Die wirtschaftsgeografische Lage bestimmt das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial. Ganz kleine Gemeinden können Standortvorteile aufweisen, die alle Nachteile aufgrund der suboptimalen Grösse aufwiegen. So gibt es in der Schweiz immer noch einige ganz kleine Berggemeinden, denen es als Standortgemeinden von Wasserkraftanlagen aufgrund der kantonalen Wassernutzungsgesetzgebung wirtschaftlich sehr gut geht.
Finanzpolitische Sicht
Oft führt das kantonale Recht durch seine Vorgaben über den Finanzhaushalt der Gemeinden und durch die Regelungen zum innerkantonalen (beziehungsweise interkommunalen) Lasten- und Finanzausgleich dazu, dass sich eine Gemeinde die Frage nach der optimalen Grösse nicht stellen muss oder gar nicht stellen darf. Insbesondere die Vorschriften über den Finanzausgleich stellen hinsichtlich der Fusion von Gemeinden oft falsche Anreize. So wird beispielsweise im Kanton Bern zurzeit noch bei bestimmten demografischen und finanziellen Konstellationen die vom Kanton bei einer Gemeindefusion ausgerichtete einmalige Kopfprämie schon in den ersten Jahren dadurch neutralisiert, dass die fusionierte Gemeinde im Finanzausgleich – anders als die Einzelgemeinden vor einer Fusion – neu zu den Nettozahlern gehört und Abgaben in den Ausgleichstopf entrichten muss. Eine Gesetzesrevision ist nun allerdings eingeleitet.
Fusionsabklärung als Führungsaufgabe
Zumindest aus der Sicht der Gemeinde selbst stellt die Zahl der Einwohnenden für sich kein taugliches Kriterium für einen Fusionsentscheid dar. Es gehört aber dennoch zu den Führungsaufgaben von Gemeindeexekutiven, die Frage, ob die Gemeinde noch eine optimale Grösse aufweise, periodisch unter allen aufgezeigten Aspekten zu prüfen. Wenn sich die Grösse der Gemeinde als nachhaltig suboptimal herausstellt und die Möglichkeiten von IKZ nicht gegeben oder schon ausgeschöpft sind, dann stellt sich ernsthaft die Frage einer Fusion. Allerdings gehören zu einer Gemeindefusion mehrere sich anbietende Partner, deren Zusammenschluss mit der eigenen Gemeinde auch wirklich eine Optimierung der betriebswirtschaftlichen, soziodemografischen, raumplanerischen und wirtschaftsgeografischen Lage erhoffen lässt. Gegenüber der IKZ haben Fusionen durchaus auch den Vorteil, dass die Steuerung der Gemeindedienstleistungen wieder vollständig transparent und mit demokratischen Instrumenten erfolgen kann und das der administrative Aufwand wegfällt, der gemeindeseitig zur Verwaltung und Steuerung der IKZ immer verbleibt (Verträge, Mitwirkung in Gremien).
Zurzeit besteht in der Schweiz ein Trend zu Gemeindefusionen und zur Erprobung neuer regionaler Zusammenarbeitsformen. Jede vierte Gemeinde befasst sich derzeit in irgendeiner Form mit Fragen einer möglichen Fusion. Der Druck zur Fusion auf kleine und kleinste Gemeinden wird in den nächsten Jahren aufgrund der zu erwartenden soziodemografischen und finanzpolitischen Entwicklungen einerseits und der ständig wachsenden Ansprüche der Bevölkerung an staatliche Dienstleistungen andererseits zunehmen. Zudem besteht ein gewisser Trend, kleine Gemeinden ganzer Regionen und Talschaften zu einer Gemeinde zusammenzuschliessen, auch wenn solche Bestrebungen in jüngster Zeit nicht immer erfolgreich waren. Mittelfristig könnten in der Schweiz somit allenfalls nicht mehr die sehr kleinen Gemeinden ein Problem darstellen, sondern jene Gemeinden mit 2000 bis 4000 Einwohnenden, die zwischen den fusionierten Gemeinden den Anschluss verpassen, aufgrund der angeschlossenen Optimierung als Fusionspartner nicht mehr erwünscht sind und dadurch ihr Entwicklungspotenzial verlieren. Für eine vorteilhafte Weiterentwicklung der Schweiz ist es deshalb von Bedeutung, dass die Frage der Gebietsabgrenzungen auf Gemeindeebene (allenfalls auch im Bereich bestehender Kantonsgrenzen) künftig pragmatisch und emotionslos angegangen wird, als eine Möglichkeit, die Erbringung staatlicher Aufgaben vor Ort zu optimieren, die gleichwertig neben IKZ und neuen Formen der regionalen Zusammenarbeit steht. Diesbezüglich sind auch die Kantone in ihrer strategischen Planung gefordert.
*Daniel Kettiger ist Rechtsanwalt, Verwaltungswissenschafter und Berater und befasst sich seit Längerem mit Gemeindefusionen, unter anderem im Forschungsprojekt «Fusionsabklärungstools» des Kompetenzzentrums für Public Management der Universität Bern (KPM) und im Gemeindestrukturreformprojekt des Kantons Uri.