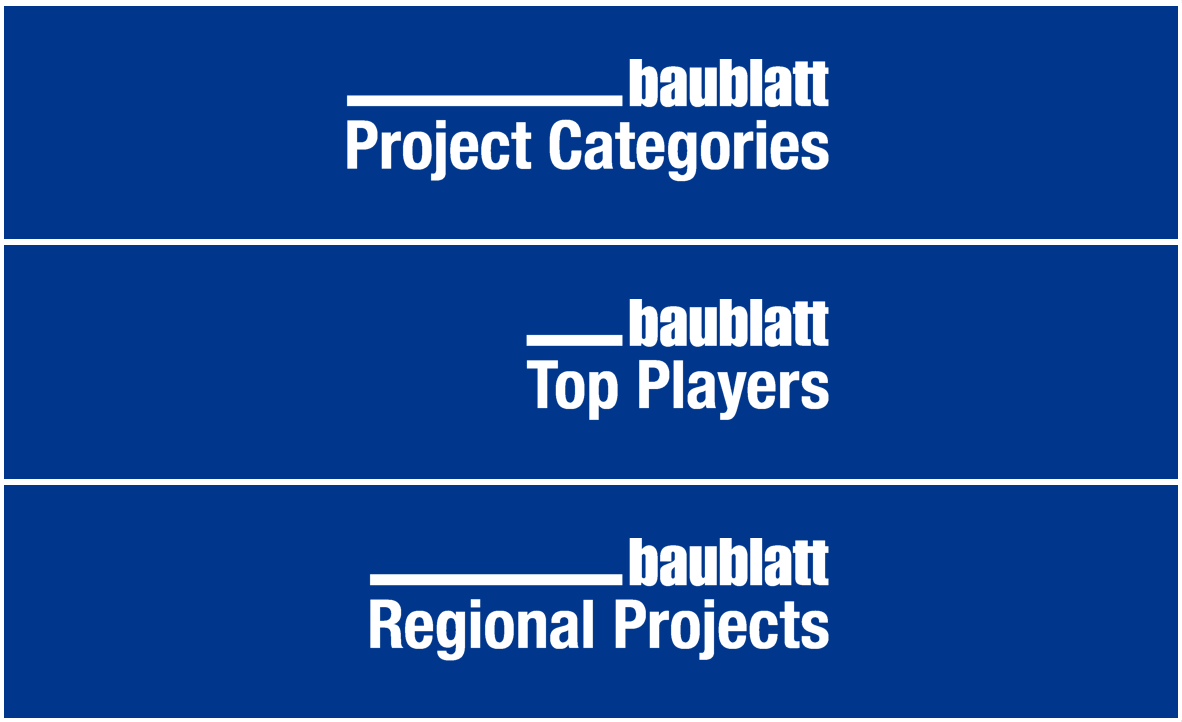Damit sich die Quagga-Muschel in den Seen nicht weiter ansiedelt
Die invasive Quaggamuschel kann massive Schäden verursachen. Um ihre Ausbreitung in Schweizer Seen einzudämmen, raten Fachleute der Eawag schnell zu handeln. Allerdings sind Schutzmassnahmen zum Teil sehr aufwendig und müssen langfristig geplant werden.

Quelle: Eawag, Linda Haltiner
Filter und Wärmetauscher können Infrastrukturanlagen vor sich festsetzenden Muscheln schützen.
«Für jeden See ist jedes Jahr, in dem die Quaggamuschel nicht gefunden wird, ein gewonnenes Jahr», erklärt Piet Spaak, Biologe und Quaggamuschelexperte der Eawag. Dies, die gewonnene Zeit kann dazu genutzt werden kann, Infrastrukturanlagen mit Wasserleitungen, die Seewasser führen, auf die Quaggamuschel vorzubereiten, sollte sie sich eines Tages doch in dem betreffenden See ausbreiten. So können zum Beispiel Filter und Wärmetauscher sensible Geräteteile vor sich festsetzenden Muscheln schützen und auf diese Weise irreversible Schäden an Gebäuden und Anlagen verhindern. Allerdings sind dafür laut Empa zum Teil sehr kostspielige Um- und Neubauten erforderlich, die von langer Hand geplant werden müssen. «Wir reden hier von Kosten, die sich für die ganze Schweiz auf Hunderte von Millionen Franken belaufen dürften», sagt Spaak.
Welche Präventions- und Schutzmassnahmen braucht es gegen die Quaggamuschel?
Vor Kurzem ist der Bericht «Quaggamuschel: Monitoringkonzept und Empfehlungen zu Präventions- und Schutzmassnahmen» erschienen, er ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Wasserforschungsinstituts Eawag mit Fachleuten des Cercle Exotique, einer Arbeitsgruppe der Konferenz der kantonalen Umweltämter (KVU). Er richtet sich an Behörden, Wasser-, Wärme- und Kälteversorgungen sowie weiteren Entscheidungsträgern soll ihnen konkrete Empfehlungen, wie sich die Verbreitung der Quaggamuschel eindämmen lässt bieten. «Für die beste Wirkung sollten diese Massnahmen so rasch und flächendeckend wie möglich umgesetzt werden», erklärt Spaak.
Nicht von der Molluske
befallenen Seen sollte laut Eawag mindestens einmal pro Jahr mit einer
Umwelt-DNA-Analyse untersucht werden, um eine mögliche Besiedelung durch
die Quaggamuschel frühzeitig erkennen zu können. Solches hilft den
zuständigen Behörden nicht nur schnell zu reagieren, sondern auch zu
überprüfen, ob die getroffenen Schutzmassnahmen genügen. Als wichtig
erachten die Autoren Meldungen aus der Bevölkerung.
Muscheln werden über Freizeitboote in die Gewässer eingeschleppt
Gemäss dem Bericht verbreitet sich die Quaggamuschel in der Schweiz hauptsächlich durch den Transport von Freizeitbooten. Hier ortet die Studie den grössten Ansatz: Um zu verhindern, dass die Quaggamuschel in bisher nicht betroffenen Gewässern Fuss fasse, eigneten sich am besten weitreichende Schutzmassnahmen, wie zum Beispiel eine Schiffsmelde- und -reinigungspflicht. Rund um den Vierwaldstättersee, im Kanton Bern und in ähnlicher Art und Weise im Kanton Aargau am Hallwilersee sind solech Vorgaben bereits eingeführt worden. Die Kantone St. Gallen, Graubünden und Zürich haben sich ab diesem Monat angeschlossen. Weitere Kantone, wie der Kanton Glarus wollen folgen.
Eine Schiffsmelde- und
-reinigungspflicht hilft zudem auch gegen die Einschleppung und
Verbreitung anderer invasiver Arten. Das gilt zum Beispiel für das
Schmalrohr, einer schnellwüchsige Unterwasserpflanze, und für die
Schwarzmundgrundel, einer invasiven Fischart. Allerdings werden in der
Studie auchz Wissenslücken bei der Durchführung der Schiffsreinigung
festgestellt: «Detaillierte, praxisgetestete Reinigungsmethoden und
-anleitungen, zusätzliche Reinigungsstellen sowie auf die Praxis
zugeschnittene Forschung könnten hier hilfreich sein», schreibt die
Eawag in ihrer Medienmitteilung.
Dank Forschung weitere Ausbreitung der Quaggamuschel eindämmen
Um die langfristigen Folgen für die Ökosysteme zu verstehen, orientiert sich die Forschung derzeit an den Erfahrungen mit den nordamerikanischen Seen: Hier ist die Quaggamuschel schon 20 Jahre früher als in Europa eingeschleppt worden.
Das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach einer spezifischen Folgenabschätzung für die Schweizer Gewässer sei jedoch gross, schreibt die Eawag. Dafür bedarf es allerdings weiterer Untersuchungen. Die Studienautoren raten deshalb, die bereits betroffenen Seen einmal pro Jahr standardmässig zu untersuchen. Ausgewählte Seen, die in der Vergangenheit bereits detailliert von Forschungsinstituten untersucht wurden, sollten auch detailliert überwacht werden, indem alle ein bis zwei Jahre Proben an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Tiefen genommen werden. Dies, damit die so gewonnen Daten in die Planung von Präventionsmassnahmen einfliessen können. (mgt/mai)
Quaggamuschel-Fachstelle der Eawag
Seit dem 1. April finden Verantwortliche bei der Quaggamuschel-Fachstelle der Eawag Unterstützung. Sie soll Behörden und Fachleuten mit Informationen und Know-how versorgen. Sie wird vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) sowie von der Eawag finanziell unterstützt. Zudem wird laut Eawag auch eine Zusammenarbeit mit den internationalen Kommissionen zum Schutz von Genfer-, Boden- und Luganersee sowie des Lago Maggiore angestrebt. (mgt/mai)
Mehr dazu auf: https://www.eawag.ch/de/abteilung/eco/projekte/eawag-quagga-fachstelle/