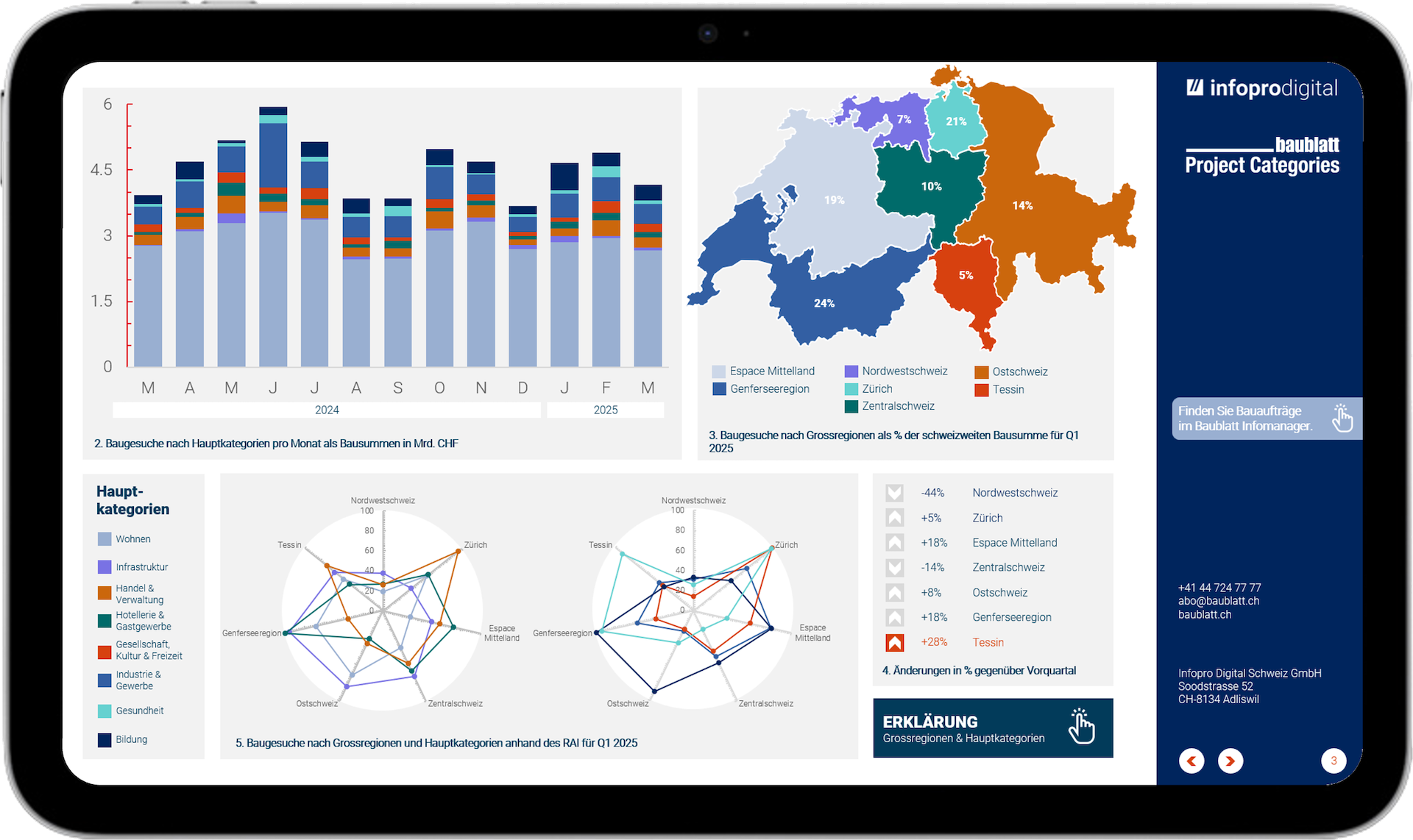Auspacken und anfangen?
Von Patrick Aeschlimann
Es ist der Traum eines jeden Computernutzers: Plug & Play – einstecken und loslegen. Ob ein solch simples, modular aufgebautes und massgeschneidertes Konzept auch im E-Government funktionieren kann, war Diskussionsgrundlage des 8. nationalen «eGovernment-Symposiums» im Berner Stade de Suisse.
Keine Parkkarte für Bundesrätin
Zur Eröffnung machte Bundesrätin und EJPD-Vorsteherin Simonetta sich grundsätzliche Gedanken über die digitale Zukunft und den Platz, welchen der Staat in dieser einnehmen kann und soll. Sie hielt fest: «Der Staat muss seine Rolle im digitalen Zeitalter teilweise erst noch finden.» Als praktisches Beispiel nannte die Bundesrätin die Langzeit-Parkkarte für die blaue Zone in ihrer Wohngemeinde Köniz: «Das ist ein typisches Angebot, das der Bürger online kaufen will.» Auf der Website der Gemeinde fehlt dieser Service aber. Sommaruga ist sich bewusst, dass die Zukunft vieler staatlicher Dienstleistungen im Internet liegt.
Mehr noch: «Mit Hilfe von E-Government kann unsere Demokratie weiterentwickelt werden.» Gerade die junge Generation sei mit dem Wählen und Abstimmen manchmal überfordert. Man müsse sich die Frage stellen, ob das Abstimmungsbüchlein, in gedruckter Form oder als PDF, noch zeitgemäss sei, wenn die Jungen doch permanent via Smartphone online seien. «E-Government macht das Leben für alle einfacher, die sich in der digitalen Welt zurechtfinden», ist die Bundesrätin überzeugt.
Wichtig sei aber auch das Bewusstsein, dass das Abgeben der Stimme schwerwiegendere Konsequenzen habe als ein «like» auf Facebook. Gegenüber E-Voting ist Sommaruga zwar grundsätzlich positiv eingestellt, allerdings stehe sehr viel auf dem Spiel, falls es mal zu einer Panne komme: «Wenn die Qualität eines E-Voting-Services nicht hundertprozentig stimmt, droht das Vertrauen in den Staat verloren zu gehen. Das wäre Gift für unsere direkte Demokratie.» Falls man die Schwierigkeiten aber überwinden könne, sei E-Government generell in 20 Jahren eine Selbstverständlichkeit, ist sich die Magistratin sicher.
Standardisierte Services nötig
Für Torsten Kaiser, bei IBM zuständig für den öffentlichen Sektor im deutschsprachigen Raum, ist das E-Government aus dem Baukasten durchaus machbar, wenn auch nicht sofort. Er sieht vor allem ein Problem bei den Schnittstellen, die den modularen Aufbau von E-Government-Lösungen erst ermöglichen, und bläst punkto mobile Nutzung ins gleiche Horn wie die Bundesrätin: «Eine elektronische ID etwa kann heute nur funktionieren, wenn man sie auch mit Smartphone und Tablets nutzen kann.»
Das sei dem deutschen elektronischen Personenausweis (EPA) zum Verhängnis geworden. Um diesen sinnvoll einzusetzen, musste man ein teures Lesegerät kaufen, welches aber nicht am gleichen Ort wie die Karte bezogen werden konnte. Eine Schlüsselrolle zum E-Government aus dem Baukasten kommt laut Kaiser dem Verein «eCH» zu: «Nach der Standardisierung von Schnittstellen sollte zur Standardisierung von Services übergegangen werden.»
Eine Vision konnte Jean-François Junger, bei der EU-Kommission verantwortlich für den Bereich E-Government, präsentieren. In der europäischen Union gibt es noch mehr Doppelspurigkeiten bei der Datenerfassung als in der Schweiz. Er erwähnt das Beispiel des Förderprogramms «Horizon 2020» für Forschung und Innovation. «Jede Information wurde von der EU-Kommission noch einmal erfasst, obwohl sie auf nationaler Ebene bereits vorhanden war.» Schuld an solchen überflüssigen Erfassungen sei nicht zuletzt der Datenschutz. Es sei daher umso wichtiger, soviele Daten wie möglich zu teilen, so Junger.
Solange die Bürger jeden Datenaustausch selber autorisieren müssen, sei das Problem ohnehin minim, sagt Junger. Zusammenarbeit, Transparenz und Partizipation lauten die Prinzipien seiner Vision für zeitgemässe öffentliche Dienstleistungen. Für Junger ist klar, dass ein solcher Ansatz zu einem Wandel in der Beziehung zwischen Bürger, Politik und Verwaltung führen wird.
Fest steht: der Datenschutz wird künftig einen anderen Stellenwert haben, wenn die Generation, welche mit Facebook, Google und Twitter gross geworden ist, an den Schalthebeln der Macht sitzt. Eine Anekdote aus der Schule seiner 17-jährigen Tochter verdeutlicht den kontradiktorischen Umgang der Jungen mit dem Datenschutz: Die Lehrerin hatte zur Sensibilisierung betreffend Umgang mit Daten eines Tages alle öffentlich zugänglichen Facebook-Profile ihrer Schüler ausgedruckt und im Schulzimmer aufgehängt. «Die Schüler waren entsetzt, schockiert. Solange die Informationen ‹nur› im Internet ersichtlich waren, sahen sie kein Problem. Bei der Aktion der Lehrerin hingegen schon», so Junger.
Unsicherheit wegen Gutachten
Bereits praktische Erfahrungen mit E-Government aus dem Baukasten haben Urs Paul Holenstein und Thomas Steimer vom Fachbereich Rechtsinformatik des Bundesamts für Justiz. Aus der Idee, dass einmal definierte und realisierte Services auch in anderen Projekten und Anwendungen genutzt werden und weitere Nutzern zur Verfügung gestellt werden können, entwickelte ihre Abteilung als Open-Source-Software den Validator für Strafregisterauszüge und das Urkundspersonenregister (Upreg).
Schnell waren sie an einem Punkt, an dem alle fortschrittlichen E-Government-Projekte früher oder später landen: bei den rechtlichen Fragen. Die wichtigsten fasste Steimer zusammen: «Darf ein für eine Mehrfachnutzung geeigneter Service überhaupt für eine solche zur Verfügung gestellt werden? Was passiert, wenn beschaffungsrechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen durch die Mehrfachnutzung überschritten werden?» Ein aktuelles Rechtsgutachten, das auf eine parlamentarische Interpellation von GLP-Nationalrat Thomas Weibel zurückgeht, kommt zum Schluss, dass der Bund nur eingeschränkt Open-Source-Software entwickeln dürfe.
Insbesondere spiele es eine Rolle, ob eine solche Weitergabe eine privatwirtschaftliche Tätigkeit des Staates darstellt, eine «Nebentätigkeit der Verwaltung» ist, oder eine «Randnutzung des Verwaltungsvermögens.» Für diese Kategorien bestehen unterschiedlich stringente Zulässigkeitskriterien.
Wenn die öffentliche Hand zum Softwarehersteller und somit zum Konkurrenten von privaten Firmen wird, ist das nach Meinung vieler problematisch. Insbesondere wenn Dritte, im Speziellen Privatpersonen, die Software ebenfalls nutzen können. In diesem Fall müsste man dafür, zur Gewährleistung der Wettbewerbsneutralität, einen zumindest kostendeckenden Preis verlangen, heisst es im Gutachten.
Für Steimer ist das rechtlich nicht bindende Gutachten aus verschiedenen Gründen problematisch: «Es wirft mehr Fragen auf, als geklärt werden, wir müssten unseren beliebten Validator vom Netz nehmen und es gibt Verwaltungen das Signal, nichts Selbstentwickeltes weiterzugeben.»
Das hingegen wäre fatal, wie Stephan Röthlisberger, scheidender Leiter der Geschäftsstelle E-Government Schweiz, antönt: «Auf Gemeindeebene steigt die Komplexität der E-Government-Vorhaben stetig. Ohne Zusammenarbeit, auch mit den Kantonen, geht bald nichts mehr.»
Ins gleiche Horn bläst Marco Bürli, Leiter E-Government-Projekte im Kanton Aargau, der am Symposium den E-Government Sonderpreis Schweiz für die kantonale E-Government-Infrastruktur entgegennehmen durfte: «Für kleine Gemeinden ist das heute benötigte Know-how kaum zu bekommen, und die notwendigen Investitionen sind kaum zu stemmen.» Problematisch wird es laut Bürli dann, wenn von einer Lösung primär die Gemeinden profitieren, aber nur der Kanton sie entwickeln kann. Spätestens nach diesem Votum war klar, dass wir vom Baukastenprinzip noch weit entfernt sind. ■