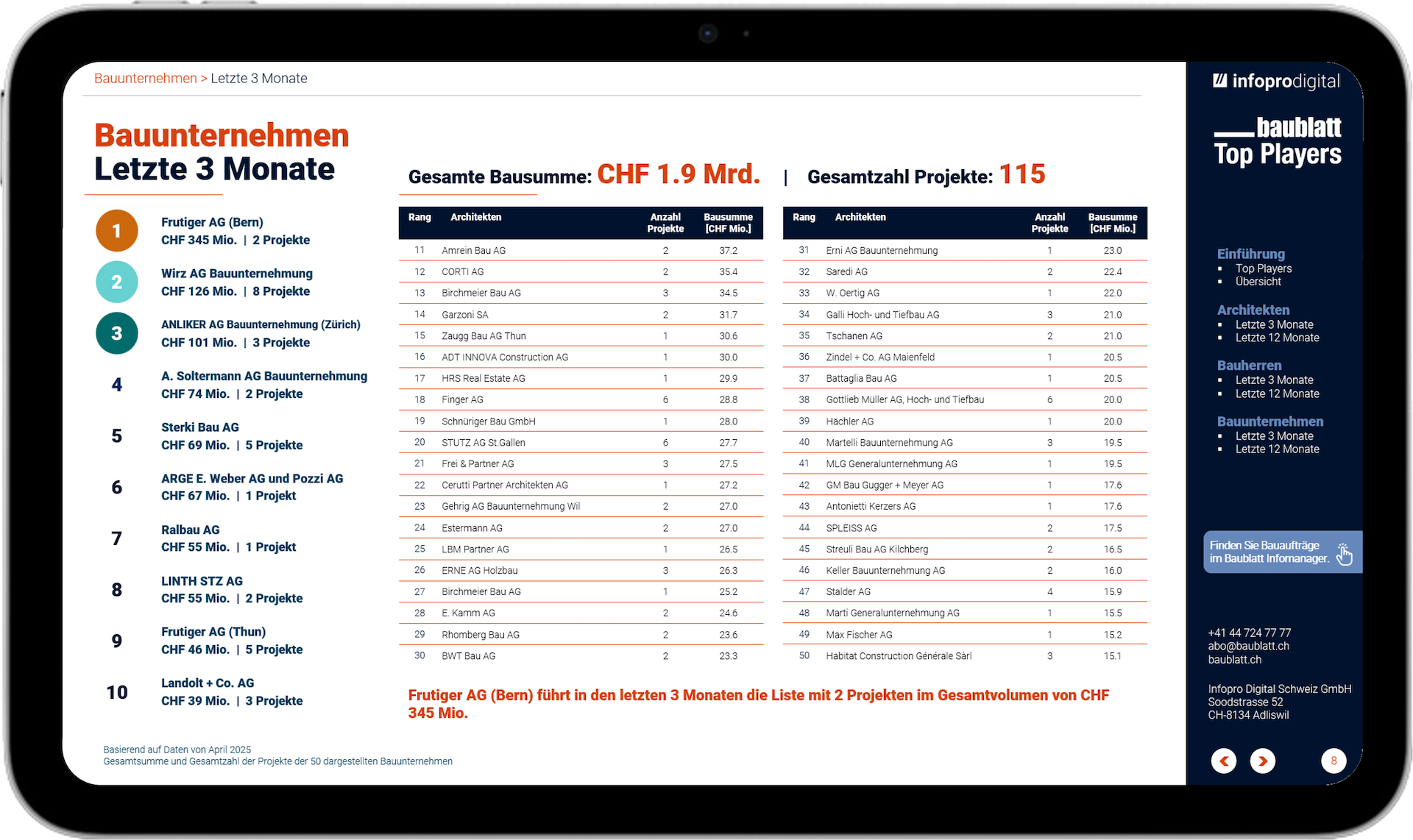Buchtipp: Die Wunderwelt von Sand
Ob auf dem Bau oder am Strand – ohne Sand geht nichts. Das kaum beachtete Material birgt eine erstaunliche Wunderwelt in sich. Der Autor Oliver Lenzen trägt in seinem Werk «Das grosse Buch vom Sand» viele Details über das alltägliche Material zusammen.

Quelle: Oliver Lenzen
Die Rohne zwischen Leuk und Siders. Gletscher- und Flusssedimente mischen sich, werden in Kies- und Sandbänken zwischengelagert und später weitertransportiert. Je nach Gefälle und Strömung kann es zwischen tausend und einer Million Jahre dauern bis ein Sandkorn in einem Fluss eine Strecke von 100 Kilometern zurückgelegt hat.
Keine Baustelle ohne Sand. Aber wer käme je auf die Idee,
dass es sich lohnen könnte dieses alltägliche Material genauer anzusehen? Es
beginnt ja schon damit, dass es einen gewaltigen Unterschied macht wie grob
oder fein Sand ist. In den 1920er Jahren hat der Geologe Chester Wentworth
eigens eine Skala dafür entworfen. Sie beruht auf Verdopplungen des
Durchmessers und ist heute als DIN EN ISO 14688 in Gebrauch.
Seiner Einteilung nach wäre Sand, der so grob ist wie unser
Haushaltszucker als Grobsand definiert, also mit Korngrössendurchmessern
zwischen 0,63 – 2 Millimetern. Und da Wentworth nur die Korngrösse, aber nicht
das Material definiert, ginge der Zucker streng nach Tabelle tatsächlich als
Grobsand durch.
Berechtigte Millimeterspalterei
Die grosse Mehrheit der Sandkörner hat übrigens nur einen
Millimeter Durchmesser und fällt damit ebenfalls unter Grobsand. Zum Vergleich:
Feinsand darf maximal 0,2 Millimeter Durchmesser haben. Das und viele, viele
andere Details über das alltägliche, wenig beachtete Material hat der offenbar
enorm sandbegeisterte Autor Oliver Lenzen in seinem lesenswerten und
umfangreichen Werk «Das grosse Buch vom Sand» zusammengetragen, das im Haupt
Verlag erschienen ist.
Diese Millimeterspalterei scheint kleinlich. Sie hat aber
ihre Berechtigung, wie er ausführt. Ein Sandkorn mit einem Durchmesser von zwei
Millimeter hat den dreissigfachen Durchmesser und die tausendfache Fläche eines
Sandkorns mit 0,063 Millimetern. Die Masse ist gleich 32 000 mal grösser. Und
hier wird es für die Physiker spannend.

Quelle: Oliver Lenzen
Atlantiksand vom Kap der Guten Hoffnung, Südafrika. Die durchsichtigen, kantigen Quarzkörner stammen von Felsen, die bis in die Bucht reichen. Die Körner biologischen Ursprungs sind ebenfalls gut erkennbar. Etwa die farbigen Seeigelstachel oder das Bruchstück einer Seepocke links oben. Der Bildausschnitt wäre unvergrössert 6,6mm breit.
Kleine Körner reisen weit
Das physikalische Verhalten des Sandes hängt direkt von der
Masse des Korns ab. Im Fluss mitgeführter Sand oder Wüstensand, der vom Wind zu
Dünen aufgetürmt, verhält sich je nach Korngrösse unterschiedlich. Kleine Sandkörner
reisen weiter, egal ob sie im Bach treiben oder vom Wind verweht werden. Das
Phänomen kennen wir von unseren Autos, die ab und zu nach dem Regen plötzlich
gelb überstäubt sind, weil Saharasand mit den Windströmungen bis zu uns gereist
ist.
Sehr kleine Sandkörner werden als Schwebfracht sehr schnell und sehr weit von der Flussströmung mitgenommen. Grössere rollen und hüpfen über kurze Strecken am Grund des Flusses als so genannte «Springfracht» dahin und kommen immer wieder kurz oder länger zur Ruhe. Die Strömung in Flüssen ist in Bodennähe nur sehr gering. Ausserdem kommt es darauf an, wie rau und somit wie bremsend das Flussbett ist. Ein Kiesbett etwa ist rauer als ein Sandbett.

Quelle: Naturhistorisches Museum Basel Michael Knappertsbusch
Eine noch heute vorkommende Coccolithophoride: Calcidiscus leptoporus. Solche einzelligen Algen sind nur Bruchteile von Millimetern gross. Ihre Kalkplättchen bilden einen grösseren Anteil des Meeresbodens in der Tiefsee. Auch im Feinanteil des Kalkes, den man für die Zementherstellung verwendet gibt es ähnliche Gebilde von Coccolithen. Zum Grössenvergleich: Der horizontale weisse Strich am oberen linken Bildrand ist einen tausendstel Millimeter lang.
Die gröberen Sandkörner taumeln also in einem Wechselspiel aus Auftrieb, Vortrieb der Strömung und Absinken im Fluss voran. Der Grossteil der Sandkörner wird irgendwann im Strömungsschatten einer Ausbuchtung des Flusses oder in einem Schwemmfächer für lange Zeit abgelagert, von anderen Sedimenten überdeckt und erst viel später etwa von mächtigen Schmelzwasserströmen wieder herausgelöst und weitertransportiert.
Je nach Gefälle und Strömung kann es zwischen tausend und einer Million Jahre dauern, bis ein Sandkorn im Fluss eine Strecke von 100 Kilometern zurückgelegt hat. Winzige Schwebpartikel wie Schluff oder Ton können dieselbe Strecke bei rassiger Strömung in wenigen Stunden schaffen.
Granit als Quelle
Woher aber stammt Sand? Klar, im Grunde aus verwittertem
Gestein, weiss man. Aber aus welchem? Da Granit und granitähnliche Gesteine die
häufigsten kristallinen Gesteine sind, bilden sie auch die Hauptquelle aller
Quarzsandkörner auf den Kontinenten. Allein der Mississippi transportiert eine
jährliche Schwebfracht von 470 Millionen Tonnen, wie Lenzen schreibt.
Achtzig bis neunzig Prozent der europäischen Küstensande kommen über
Flusstransporte zum Meer.
Im Meer selbst sieht das Ganze schon anders aus. Dort sind
es beträchtliche Mengen an Überresten von Schalen oder Skelette winziger
Lebewesen, die den Sand und vor allem den Tiefseeschlamm bilden. Und das obwohl
Flüsse und Wind massenweise Quarzsand ins Meer bringen (siehe Interview unten). Mit
blossem Auge halten wir Laien diese winzigen Schalen für Sandkörner. Erst unter
dem Mikroskop wird sichtbar, dass es erstaunlich filigrane Gebilde sind.

Quelle: Oliver Lenzen
Ausgewählte Sandkörner biologischen Ursprungs aus Darwin, Australien. Abgebildet sind sechs Sklerite in rot, orange und hellgelb, dazu Foraminiferen und Schneckenhäuschen sowie zwei transparente Quarzkörner. Das Bild wäre im unvergrössert 6,5mm breit.
200 Tonnen pro Einfamilienhaus
Lenzen geht auch auf den Sandverbrauch der modernen Gesellschaft ein. Ein Einfamilienhaus braucht 200 Tonnen Sand, ein Kilometer Autobahn 30 000 Tonnen. Der Pro Kopf Verbrauch allein in Deutschland beträgt neun Tonnen pro Jahr. China ist der grösste Sandverbraucher überhaupt. Im Jahr 2016 wurden dort 7,8 Milliarden Tonnen Sand verbaut.
So wird Sandraubbau
längst zu einem Problem, das es auch immer mehr in die Medien schafft. Da Sand
nicht als Rohstoff geschützt ist, sei die Ahndung schwierig, schreibt Lenzen.
Um so unverständlicher, dass das Betonrecycling nicht längst weiter
fortgeschritten ist.
Sandhungriges Fracking
Ein weiteres grosses Thema sind die besonders feinen und
scharfkantigen Sande, die es für das vor allem in den USA beliebte und teils
sehr umstrittene Fracking braucht. Beim Fracking wird ölhaltiges
Schiefergestein mit Hilfe von unter hohem Druck stehenden, mit Chemikalien
versetzten Wassers aufgebrochen und über Bohrlöcher gefördert. Damit sich die auf
diese Weise erzeugten Bruchstellen im Schiefer nicht wieder schliessen, wird
dem Wasser auch Quarzsand beigefügt. Allein im Jahr 2016 wurden in den USA
siebzig Millionen Tonnen des seltenen und begehrten Fracking-Sandes abgebaut.
Sand ist zwar in Massen vorhanden auf der Erde – ihn mit Bedacht zu verwenden, stünde dem Menschen trotzdem gut an. Gerade die Sandarten, die es für den Bau braucht, sind nicht unendlich vorhanden. Solange Polymerbetone nicht weiterentwickelt sind, können wir kaum auf Wüstensande zurückgreifen, wenn wir mit dem kantigeren und haftfähigeren Bausand nicht sorgsam genug umgegangen sind.
Und welche filigranen Wunderwerke wir da für
Sandkörner halten und in den Beton rühren, das macht Lenzens Buch bewusst. Je
länger man darin liest, desto besser kann meine seine Faszination für das
scheinbar banale Material verstehen.
Buchtipp
Das grosse Buch vom Sand; Die Vielfalt im Kleinen; Autor: Oliver Lenzen; ISBN: 978-3-258-08270-7; 368 Seiten; Haupt Verlag; CHF 46.00


Quelle: Alexandra von Ascheraden
Michael Knappertsbusch (63) ist Geologe und Mikropaläontologe. Er arbeitet seit 1994 als Kurator für Mikropaläontologie am Naturhistorischen Museum in Basel.
Interview mit Michael Knappertsbusch: Sandkörner – Wunderwerke im Beton
Was für Laien normale Sandkörner sind, erkennt der Mikropaläontologe Michael Knappertsbusch als winzige Fossilien. Aus einst mikroskopisch kleinen Kalkalgen im Jurameer wird auch Portlandzement hergestellt. Eine Entdeckungsreise in eine unbekannte Mikrowelt.
Baublatt: Michael Knappertsbusch, Sie sind Mikropaläontologe, beschäftigen sich also mit winzigen Fossilien. Was hat das mit Bausand zu tun?
Michael Knappertsbusch: Oh, mehr als die Leute glauben. So werden zum Beispiel für den Portlandzement Juraschichten bei Wildegg abgebaut. Der Kalkstein und die Mergelvorkommen dort sind besonders gut als Ausgangsstoff geeignet. Der feine Kalkanteil besteht unter anderem aus den Kalkschälchen winziger Kalkalgen, die im damaligen Meer als Plankton lebten. Deren Reste finden wir heute noch in den Ablagerungen dort. Solche und andere planktonische Mikrofossilien aus Meeresablagerungen sind mein Spezialgebiet. Ich arbeite am Naturhistorischen Museum in Basel und betreue dort Forschungssammlungen mit Mikrofossilien. Darunter sind umfangreiche Sammlungen von Meeressanden aus der Tiefsee oder dem Flachmeer aus der ganzen Welt, die eine reichhaltige Welt an Mikrofossilien enthalten.
Was fasziniert Sie so am Sand?
Wenn die Leute wüssten auf was sie da am Strand ihr Handtuch ausbreiten sie wären fasziniert. Sand besteht nicht nur aus winzigen Gesteinsbruchstücken, wie die meisten vielleicht denken. Ein Grossteil der Meeresablagerungen, sei es aus den Tiefen des Meeres, auf dem Schelf, in Korallenriffen oder am Strand, wird von Schalen winziger Tiere gebildet, die man mit blossem Auge kaum von mineralischen Sandkörnern unterscheiden kann.
Das heisst was am Strand für Sandkörner halten können in Wirklichkeit die Schalen von einzelligen Lebewesen sein?
Ja, zum Beispiel die Gehäuse von Foraminiferen. Das sind tierische Einzeller, die wunderschöne winzige Gehäuse aus Kalk bilden. Solche Foraminiferen leben auch in den heutigen Ozeanen. Wenn sie absterben bleiben die kleinen Gehäuse zurück und werden Teil des Meeresbodens beziehungsweise des Meeressandes.
Was sehen Sie, wenn Sie solchen Sand unters Mikroskop legen?
In Japan gibt es ganze Strände mit so genanntem «Sternensand». Sie bestehen einzig aus winzigen Foraminiferengehäusen die die Form fünf- oder mehrzackiger Sterne haben. Wunderschön. Im normalen Meeressand gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Mikrofossilschalen, die aussehen wie Schneckenhäuschen, aber eben von einzelligen, Amöbenartigen Tierchen stammen. Andere Bestandteile sind winzige Bruchstücke von Korallen, Muschel- und Schneckenschälchen, Moostierchen, Algenkrusten, Muschelkrebschen, oder auch die winzigen dunkellila bis transparenten Stacheln von Seeigeln oder winzige Reste von Seelilien und Seegurken. Noch faszinierender sind Radiolarien – planktonisch lebende Strahlentierchen. Sie bilden ihre Schalen aus Kieselsäure und kommen in gewissen Meeresablagerungen in riesigen Mengen vor.
Wir reden hier von Meeressand. Der eignet sich ja leider so wenig für Zement wie Wüstensand.
Zu runde und abgeschliffene Sandkörner sind ungeeignet. Es braucht eckigere, die besser «verkanten» und so die Festigkeit von Zement steigern. Je nach Bedarf an Zementfestigkeit und Widerstandskraft gegen die Verwitterung kann zusätzlicher Sand mit entsprechenden Eigenschaften dazugemischt werden
Die Häuschen und Skelette all dieser Mikroorganismen zeigen ihre Schönheit erst unter dem Mikroskop.
Ein einfaches Binokular genügt bereits um diese Welt zu entdecken. Für die ganz kleinen Mikrofossilien – kleiner als ein Hunderstel Millimeter – braucht es stärkere Mikroskope oder gar ein Elektronenmikroskop. Mit letzterem kann man Coccolithen anschauen. Das sind meine Lieblinge. Sie zeigen eine unglaubliche Schönheit ihrer Skelette. Die Schreibkreide von Rügen besteht beispielsweise aus ihnen. Coccolithophoriden sind winzige einzellige Meeresalgen, so klein, dass man sie mit blossem Auge überhaupt nicht sehen kann. Sie umgeben sich mit fantastisch geformten Kalkplättchen so dass sie manchmal aussehen wie Miniatur-Discokugeln.
Sie haben auch zahlreiche Proben von Tiefseeschlamm in ihrer Sammlung. Was macht ihn für sie so spannend?
Etwa siebzig Prozent der Erdoberfläche sind vom Meer bedeckt und das schon seit Millionen Jahren. Über diese lange Zeit haben sich hunderte Meter dicke Ablagerungsschichten gebildet, die für Mikropaläontologen natürlich sehr spannend sind. Die Mächtigkeit dieser Schichten ist gewaltig wenn man bedenkt, dass es in der Tiefsee etwa tausend Jahre für ein paar wenige Zentimeter braucht.
Aus was besteht dieser Schlamm also?
In der Tiefsee besteht er fast ausschliesslich aus Skeletten von einer unfassbaren Anzahl von Mikrofossilschalen, ist also von Einzellern biologisch entstanden. Das hat grosse Bedeutung für die Ökosysteme in den Meeren, da sich da unten jedes Jahr Gigatonnen dieser nur unter dem Mikroskop erkennbaren Winzlinge ansammeln. Sie sorgen für den Transport von Kohlenstoff aus der Luft in die Tiefsee. Im Budget des weltweiten Kohlenstoffkreislaufs sind sie wichtiger als zum Beispiel Korallen, weil sie derart zahlreich sind. Zudem können wir aus dem Grad der Erhaltung der kalkigen Mikrofossilien ablesen, wie weit die Versauerung der Ozeane fortgeschritten ist.
Die Versauerung wird durch unsere moderne Lebensweise also den massiven Eintrag von Kohlendioxid in die Luft und in die Meere verursacht. Wo ist da die Rolle der Mikrofossilien?
Die Bildung von Kalkgerüsten wie in Mikrofossilien, sowie deren «Endlagerung in die Tiefsee» hilft der Natur, das komplizierte Budget von gelöstem Kohlenstoff im Meerwasser im Gleichgewicht zu halten. Dieses Gleichgewicht wird durch menschliche Verbrennung von Kohle, Öl und Gas mehr und mehr gestört. Mikrofossilien haben hier also eine wichtige ökologische Pufferwirkung gegen eine zu starke Versauerung der Meere.
Man sollte die Bedeutung dieser winzigen Lebewesen also nicht unterschätzen.
Allerdings. Und Beton, Zement und Fensterglas kann man aus ihnen auch herstellen. Mal abgesehen davon, dass das Mikroplankton die Basis der Nahrungskette für alle grösseren Organismen bilden: Sie sind auch in vielfacher anderer Hinsicht nützlich. Auch wenn die meisten Menschen von ihrer Existenz nichts ahnen. (Interview: Alexandra von Ascheraden)