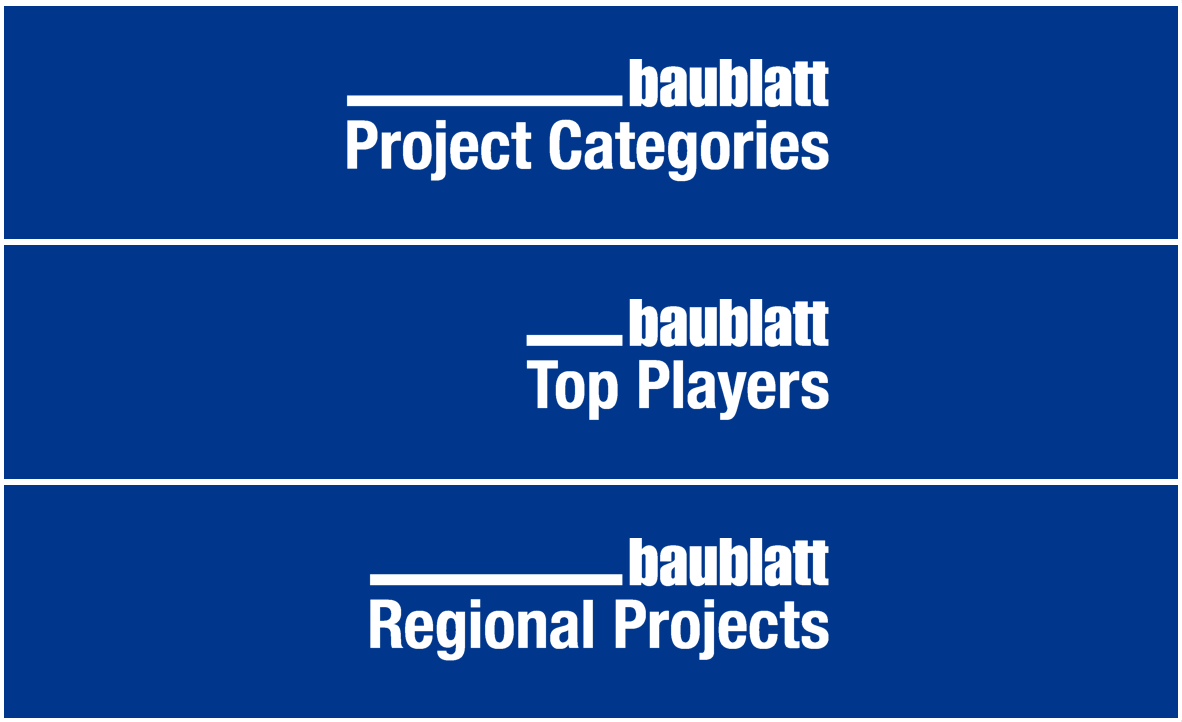Wild West im Vereinigten Königreich
Kees Christiaanse arbeitete zwei Jahre am Masterplan für die Nachnutzung des Olympic Park in Stratford, London. Im Interview erzählt der holländische Architekt und Stadtplaner, der seit 2003 an der ETH Zürich lehrt, warum er aus dem Projekt schliesslich ausstieg.
Herr Christiaanse, zusammen mit dem holländischen Architekturbüro KCAP Architects & Planners, dessen Gründer und Partner Sie sind, haben Sie 2007 den Zuschlag bekommen für eines der grössten Stadtentwicklungsprojekte in London: die Nachnutzung des Olympischen Parks in Stratford und gleichzeitig die Wiederbelebung des ehemaligen Industriegebiets Lower Lea Valley. Sie gründeten gemeinsam mit anderen Architektur- und Ingenieurbüros, die zum Teil im Vorfeld der Ausschreibung am Projekt beteiligt waren, ein Entwurfsteam. Nach zwei Jahren Arbeit sind Sie dann aus dem Projekt ausgestiegen. Warum?
Das hatte verschiedene Gründe. Erstens: Die „borrows“, die Stadtbezirke in London sind sehr autonom und unabhängig. Ihre Hoheit ist enorm, der Stadtpräsident hat deshalb nur beschränkten Einfluss. Wenn man also einen „borrow“-übergreifenden Entwurf, wie unseren «Legacy Masterplan Framework», vorlegt, müssen sehr viele Beteiligte, sowohl aus dem öffentlichen Sektor wie auch private Parteien, zustimmen. Das Problem dabei: Es gibt keine übergeordnete Autorität oder irgendeine Hierarchie, um gemeinsam Lösungen zu finden und Entscheidungen zu fällen. Sie können sich vorstellen, dass die Kommunikationsverfahren zur Konsensfindung entsprechend kompliziert sind.
Wo taten sich weitere Schwierigkeiten auf?
Das zweieinhalb Quadratkilometer grosse Gelände in Stratford wird durch ein dichtes Netz von Verkehrsinfrastrukturlinien aus Autobahnen, U- und S-Bahnen sowie Zugtrassen durchzogen. Teile des geplanten Olympischen Parks lagen daher wie auf schwer zugänglichen Inseln. Die Lösungen, die wir erarbeiteten, um Verbindungen zwischen den verschiedenen Austragungsorten zu schaffen und die Mobilitätsströme zu optimieren, stiessen auf ungeahnte Barrieren: Weder die Betreiber der öffentlichen Verkehrssysteme noch die Stadt selbst wollten die Kosten, zum Beispiel für die Umlegung von Leitungen, übernehmen. Wir haben dann Alternativen vorgeschlagen und schlussendlich wurde unser Entwurfskonzept auch genehmigt. Doch zu diesem Zeitpunkt wurde dann leider der Direktor des Olympic Legacy Office wegen Unregelmässigkeiten verhaftet. Und die Zusammenarbeit mit seinem Nachfolgern stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Als wir dann nach der Pleite der Lehman-Bank während der darauffolgenden Finanzkrise unbezahlt weiterarbeiten sollten, haben wir einen Schlussstrich gezogen.
Ihre Vision für das Olympische Gelände und das Lea Valley beschreiben Sie in Ihrem Masterplan als Open City, als ein sich gegenseitig befruchtendes Mosaik aus verschiedenen Kulturen, sozialen Schichten, Arbeitsmöglichkeiten und moderner Architektur. Hätten Sie inhaltlich eigentlich grosse Kompromisse eingehen müssen?
Naja. Allein die Tatsache, dass wir die riesenhafte Skulptur, die der indische Stahlbaron Lakshmi Mittal der Stadt London geschenkt hat und die jetzt tatsächlich errichtet wird, in unsere Vision integrieren sollten, sagt alles. Dass unser städtebauliche Entwurf von einer Zufälligkeit wie diesem Geschenk vollkommen dominiert werden sollte, ging für mich eindeutig zu weit.
Bereuen Sie im Nachhinein, aus dem olympischen Bauprojekt ausgestiegen zu sein?
Nein. Das Ironische ist aber: So wie sich der Olympiapark heute präsentiert, inklusive der Pläne für seine Nachnutzung, entspricht er fast hundertprozentig unserem Ursprungsentwurf. Unsere Nachfolger stiessen natürlich auf dieselben Probleme – und kamen offensichtlich auf vergleichbare Lösungen. Ein wenig bitter ist das schon. Letztlich war unser Ausstieg aber richtig: Die Zahlungsmoral war einfach „wild west“.
Als Architekt und Stadtplaner begleiten Sie Urbanisierungsprozesse in vielen Teilen der Welt. Wie war die Arbeit in England – im Vergleich zu Ihrer Tätigkeit in der Schweiz?
Hier begleitet der Masterplaner das gesamte Projekt bis zum Ende. Auch als Zeichen von Qualitätssicherung. Im angelsächsischen Raum dagegen ist man als „master planer“ nicht Autor des Projekts, also jemand, der ein Bauvorhaben oder eine städtebauliche Entwicklung kontinuierlich betreut, sondern man wird als Berater auf Stundenbasis eingestellt. Das ist eine ganz andere Arbeitskultur: sehr flexibel, aber eben auch unruhiger.
Peking wollte spektakuläre Bauten, London dachte dagegen in erster Linie an die Nachnutzung des Olympischen Geländes. Wird Englands Metropole damit zum Vorbild für nachfolgende Olympia-Städte?
Die Vorreiterrolle spielte schon Barcelona bei den Olympischen Spielen 1992. Hier wurden die neuen Sportstätten mit Blick auf die Zeit nach den Spielen errichtet. Stadtplanerisch entwickelte man ein ausgedehntes Netz an öffentlichen Räumen; das ganze Olympische Dorf kam als neuer Stadtteil hinzu. Der Gedanke, die Olympischen Spiele als Investition in die Zukunft einer Stadt zu nutzen ist also nicht neu. Aber die Art und Weise, wie konsequent die Engländer ihr Olympia-Projekt unter den Fokus der Nachhaltigkeit gestellt haben, ist sicher vorbildlich. Auch die Entscheidung, nur wenige Stararchitekten zu engagieren und eher auf bescheidene denn auf protzige Architektur zu setzen, gefällt mir. Jedenfalls kein Vergleich zu den Spielorten die anlässlich der Fussballweltmeisterschaft 2018 in Russland entstehen.
Haben Sie denn ein Lieblingsstadion?
Das Amsterdamer Olympiastadion des niederländischen Architekten Jan Wils. Denn bis heute dient das ebenso funktionale wie attraktive Backsteingebäude als Begegnungsstätte für Sport- und Kulturveranstaltungen.
Kees Christiaanse, geboren 1953 in Amsterdam, studierte Architektur und Stadtplanung an der TU Delft. 1989 gründete er sein eigenes Büro in Rotterdam, seit 2002 als KCAP Architects&Planners bekannt. 2006 entstand parallel zu KCAP Rotterdam ein Büro für Architektur und Stadtplanung in Zürich, 2011 eine Niederlassung in Shanghai. Zwischen 1996 und 2003 unterrichtete Christiaanse Architektur und Stadtplanung an der TU Berlin. Seit 2003 ist er Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich. Kees Christiaanse kuratierte 2009 die Internationale Architektur Biennale in Rotterdam (IABR), die dem Thema «Open City – Designing Coexistence» gewidmet war. Seit 2010 ist er Programmleiter des Future Cities Laboratory (FCL) in Singapur. Neben seiner Lehrtätigkeit und der Arbeit als Architekt ist er als Berater für verschiedene Flughäfen tätig. Christiaanse gilt als Experte im Bereich Hochschulcampus und der Wiederbelebung ehemaliger Industrie-, Bahn- und Hafengebieten. Aktuelle Projekte sind unter anderem der Masterplan für Zürichs Europaalle, eine Entwicklungsstrategie für den Schiphol Airport Amsterdam und direverse architektonische und städtebauliche Projekte in China, Russland, Spanien, Deutschland, Dänemark und Frankreich.
von Alice Werner