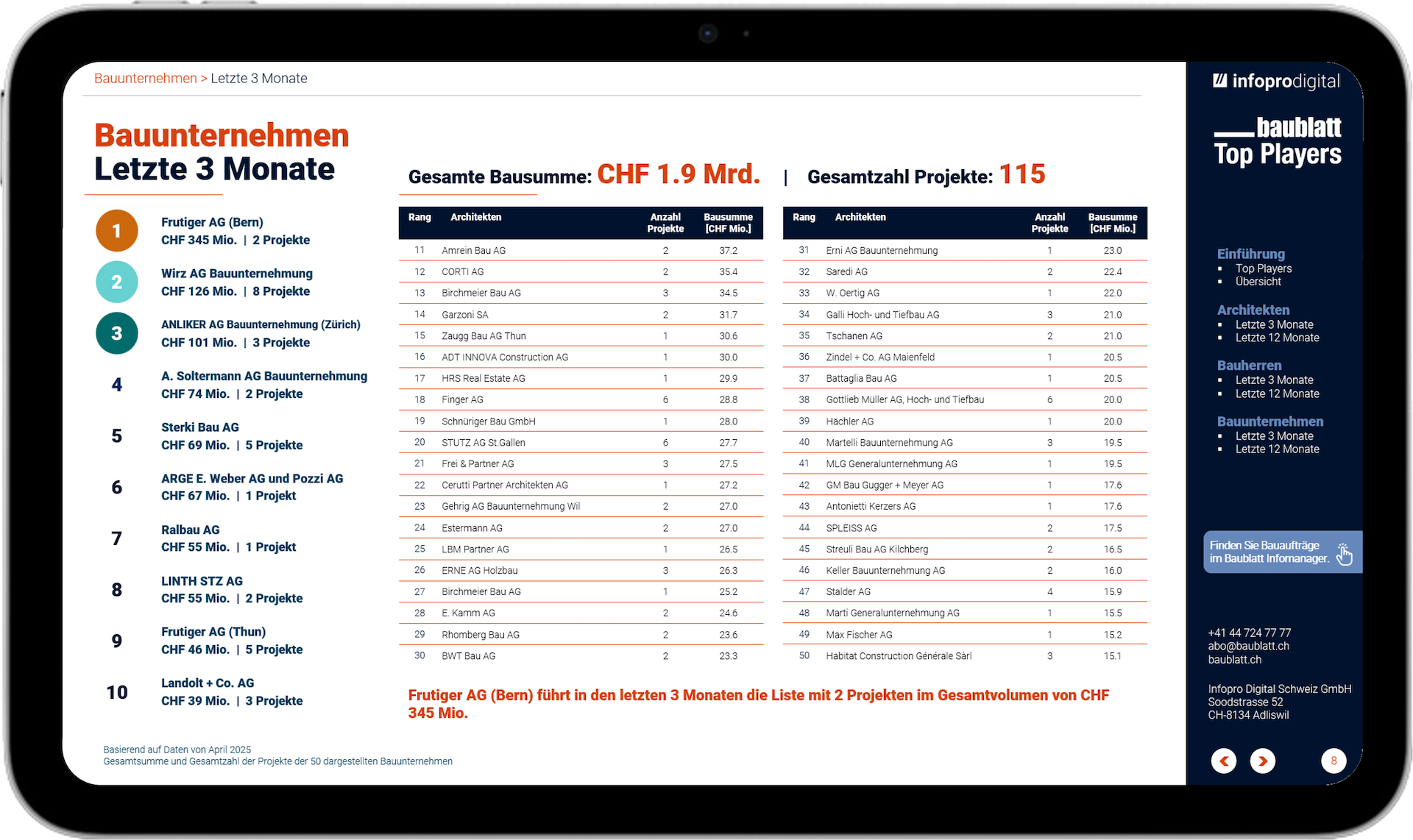Tüftler mit Leidenschaft und Herz
Der Industriedesigner Jörg Boner hat sich mit ehrlicher Arbeit und einem feinen Gespür für Objekte einen Namen in der internationalen Möbelwelt gemacht. Ein Atelierbesuch.
Die Binz, etwas versteckt am Fusse des Üetlibergs gelegen, gehört zum aufstrebenden Stadtteil Zürich-Süd. Industrie- und Bürogebäude stehen unmittelbar neben neu gebauten Wohnsiedlungen. Mitten in diesem urbanen Schmelztiegel hat sich der Designer Jörg Boner eingenistet. In einem uniformen Bau aus den 70er-Jahren befindet sich seine Ideenwerkstatt. Ich steige ein dunkles Treppenhaus hoch, bis ich neben Namensschildern von Architekten und Grafikbüros das richtige entdecke: «Jörg Boner productdesign». Nun trete ich in einen offenen, lichterfüllten Raum, der eine Portion industriellen Charme verströmt. Im hinteren Teil befindet sich das Reich von Jörg Boner und Jonathan Hotz, der seit einigen Jahren mit an Bord und weit mehr ist als ein simpler Mitarbeiter des bekannten Designers. Boner und Hotz sind ein eingespieltes Kreativduo. Bald erhält das Team Verstärkung. Umringt von unzähligen, kleinen wie grossen Kartonmodellen, begrüsst mich Jörg Boner und heisst mich willkommen in der guten Stube. Wir setzen uns in ein schlichtes Sitzungszimmer, das zusammen mit der Küche das Herzstück der funktionalen Bürogemeinschaft bildet. Der Industriedesigner erzählt mir Geschichten von seinem Wirken und seinen Möbeln, unmittelbar aus seinem Leben.
Warum sind Sie Designer geworden?
Mein Weg zum Design war kein geradliniger. Einer meiner Berufswünsche war mal Tierarzt. Bevor ich mich für den Weg eines Industriedesigners entschied, machte ich eine Schreinerlehre und liess mich anschliessend zum Innenausbauzeichner ausbilden. Bereits in jungen Jahren hatte ich eine starke Affinität zu Dingen entwickelt. Ich
liebte Gegenstände, nicht unbedingt nur Möbel. Ein verbindendes Element von gestern zu heute war und ist meine Faszination, sich in ein spezifisches Thema reinzugeben. Und dies ist im Design möglich. Man kann eine Haltung entwickeln.
Was fasziniert Sie am Thema Design?
Design hat für mich immer etwas mit der heutigen Zeit und heutigen Gesellschaft zu tun. Wenn ich gestalte und entwerfe, versuche ich Zeichen der Zeit in ein Produkt einfliessen zu lassen. Ich begebe mich auf die Suche und erhalte die Antworten auf meine vielen Fragen erst durch die Arbeit am Objekt selber.
Wie sieht Ihre Arbeitsweise aus?
Wenn jemand Bedürfnisse hat, Bedingungen stellt, ein Kontext besteht, kann ich mich besser entfalten. Im Gegensatz zur Kunst definiert sich Design über Bedingungen, die von aussen kommen. Ich würde nie mein Traumhaus bauen wollen und hätte die grösste Mühe, für mich selber zu designen. In einem Auftragsverhältnis muss ich herausfinden, wie ein Unternehmen funktioniert, was seine Geschichte ist, welche Ziele es verfolgt, wie Vertrieb und Marketing funktionieren. Diese Einschränkungen treiben mich an. So standen wir bei der Entwicklung des «Wogg 50»-Stuhls vor zwei markanten Richtlinien: Der Verkaufspreis von 600 Franken durfte nicht überschritten werden, und der Stuhl musste stapelbar sein. Anschliessend begann die intensive Entwurfs- und Entwicklungsphase.
Wie kann man sich die Entwicklung von «Wogg 50» vorstellen?
Ausgangspunkt für das neue Modell war der «Wogg 42», den ich zusammen mit dem Holztisch «Wogg 43» 2007 für den Schweizer Möbelproduzenten gestaltete. Der Unternehmer Willi Gläser kam auf mich zu und sagte spontan: «Mach doch aus dem ‹Wogg 42› einen reinen Holzstuhl.» Ich ging nach Hause und glaubte, einfach so aus dem Stuhl ein Schwesterchen zu bauen. Und je länger ich und mein Team daran gearbeitet haben, desto mehr bemerkten wir, dass dies nicht funktionierte. Wir setzten einen Neustart an und kreierten einen vollkommen neuen Stuhltyp aus Formsperrholz, der die zwei Bedingungen, Preisgrenze und stapelbar, erfüllte. Heute würde niemand sagen, dass die beiden Modelle ähnlich oder gar Bruder und Schwester sind. «Wogg 50» wäre aber nie ohne «Wogg 42» entstanden. Es brauchte für uns diesen Umweg.
Vom Auftrag, der Idee bis zum Endprodukt – wie geht ihr vor?
Wir sind zu einem Team gewachsen. Während eines Gestaltungsprozesses stehen wir in einem stetigen Austausch. Immer wieder spielen wir uns gegenseitig den Ball zu. Ich bringe eine Idee ein und sehe an der Reaktion meiner Mitarbeiter, wie gut sie ist. Es entstehen erste Ideenskizzen. Bereits sehr früh setzen wir diese am Computer um. Basierend auf den Computerzeichnungen bauen wir ein 1-zu-1-Kartonmodell. Diese Arbeitsweise haben wir über Jahre entwickelt und perfektioniert. Wir können alles im Haus anfertigen und sind extrem präzis. Der Entscheid für einen Entwurf basiert immer auf einem Kartonmodell. Eine Skizze ist für mich zu unpräzis. Ich kann mit ihr eine Stimmung festhalten, aber die endgültige Form eines Objekts kann in keiner Art und Weise aus einer Skizze erarbeitet werden. Die Ausstrahlung und Form des Stuhls «Wogg 50» könnte man nie zeichnerisch auf ein Papier bringen. Wenn beim Bau eines Prototypen ein Problem auftaucht, kann man umgehend einen Schritt zurückgehen, alles analysieren und den Entwurf wieder vorwärtstreiben. Neben der hohen Präzision interessiert uns auch das Einfache, von Hand etwas schneiden, kleben und zusammenbauen. Schon oft ist ein Modell am Ende eines Tages fertig geworden. Dann spüren wir eine tiefe Freude, öffnen den Kühlschrank und gönnen uns zur Feier des Tages ein kühles Bier. Skizzen, Zeichnungen und Ideen sind in unseren Köpfen, der fertige Stuhl gehört dem Unternehmen oder dem Käufer. Die Kartondinger gehören einfach nur uns. Sie gehören ins Atelier. Sie sind wie geisterhafte Vorwegnahmen der Endprodukte. Dieser Moment ist für mich extrem bereichernd. Bis heute hat es eigentlich kein Produkt gegeben, das so nicht funktioniert hat.
Wie hat Sie Ihre Lehrtätigkeit an der ECAL beeinflusst?
An der Ecole cantonale d’Art de Lausanne treffe ich auf eine andere Generation. Diese hat einen anderen Hintergrund, ein anderes Umfeld. Es ist für mich total spannend herauszufinden, wie meine Schüler funktionieren. Zudem habe ich in Lausanne die Designszene von Europa, wenn nicht der Welt, kennengelernt. Man trifft sich als Lehrer in einer anderen Stadt, nimmt sich Zeit und geht am Abend essen – ein ungeheurer Meinungsaustausch. Daraus sind Freundschaften fürs Leben entstanden.
Was kann ein Architekt von einem Designer lernen?
Die Arbeitsweisen sind ähnlich, doch der Inhalt vollkommen ein anderer. Ich glaube, der Sprung von Architektur zu Design ist etwa gleich gross wie derjenige von Design zu Kunst. Ein guter Künstler ist noch lange kein guter Designer und umgekehrt. So auch bei Architekten und Designern. Mit Ausnahme der alten Meister, die alle Disziplinen vereinten, habe ich schon lange keinen Architekten mehr entdeckt, der interessante Produkte gestaltete. Ich glaube, Architektur und Design haben sich zu zwei verschiedenen Themen entwickelt. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass Architekten und Designer bei bestimmten Projekten gemeinsame Sache machen und so voneinander profitieren.
Wie könnte diese Zusammenarbeit aussehen?
Mit den Architekten Rolf Meier und Martin Leder kam es bereits bei zwei Projekten zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Für den Hauptsitz des Schweizer Stromkonzerns Axpo entwickelten wir einen Plan Lumiére. Daraus resultierte der Entwurf einer Leuchtenfamilie. Nun versuchen wir, einen Teil dieser Idee in eine Serie zu bringen. Wir verstanden uns als eine Art Sparringpartner, die sich gegenseitig inspirierten. Wichtig ist, dass ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis entsteht, eine Diskussionskultur aufgebaut wird. Für eine gute Zusammenarbeit muss es auch menschlich stimmen.
Nach dem Gespräch bedankte ich mich bei Jörg Boner und verliess mit einer Erfahrung reicher das Atelier. Ich schlenderte entlang den gesichtslosen Industriefassaden in der Binz und wusste, einen Menschen getroffen zu haben, der seine Berufung gefunden hat.
von Roland Merz