Steinschlagschutz aus Holz: Auf den Spuren alter Bautechniken
Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Graubünden untersucht alte Holzpalisaden auf ihre Schutzleistung gegen Steinschlag. Mittels Belastungstests an unter anderem rund 30 Jahre alten Holzbalken wird die althergebrachte Bauweise auf Herz und Nieren geprüft.

Quelle: zvg
Wurde inzwischen rückgebaut: Die Steinschlagschutzverbauung mit Holzelementen beim Gruobenwald ausserhalb von Klosters.
Nicht immer kommt alles Gute von oben: Laut der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) sind
sechs bis acht Prozent der Landesfläche der Schweiz von instabilem Untergrund
betroffen. Hauptsächlich im voralpinen und alpinen Raum drohen Hangrutschungen,
Steinschläge oder Felsstürze. Die oft nur begrenzt vorhersagbaren Naturgefahren
bergen ohne entsprechende Schutzbauten ein enormes Schadenspotenzial. Und durch
den Klimawandel nimmt das Risiko solcher Ereignisse noch zu: Schmelzende
Gletscher und der auftauende Permafrost entlassen Steine und Felsbrocken aus
ihrem «Eisgefängnis».
Erster Steinschlagschutz aus Holz
Dieser Bedrohung war man sich bereits Anfang der
1900er-Jahre bewusst – zum Beispiel beim Bau der Rhätischen Bahn von Landquart
nach Davos. Steinschlag stellte damals wie heute für viele Bergbahnen und
Siedlungen im Bündnerland eine ständige Bedrohung dar. Dagegen gewappnet hatten
sich die Menschen zu dieser Zeit mit einfachsten Mitteln: Mit Baumaterial, das
gerade vorhanden war. «Sie haben alte Eisenbahnschienen als Stützen genutzt,
ein Loch gegraben und diese einbetoniert», erzählt James Glover, wissenschaftlicher
Projektleiter Naturgefahren an der Fachhochschule Graubünden im Baulabor in
Chur. Zwischen die Stützen platzierte man Eisenbahnschwellen aus Eichenholz.
«So entstand der erste Steinschlagschutz aus Holz».
Heute finden sich viele unterschiedliche Konstruktionsarten
solcher Holzbarrieren. Mit verschiedenen Pfostentypen, Rund- oder Kantholz.
«Bei einigen ist das Holz zum Beispiel als Vollschutz direkt aneinandergebaut»,
erläutert Glover. Andere Schutzbauten weisen dagegen zwischen den Balken
Lücken oder Abstandshalter auf und sind mit Eisenbahnschienen oder HEM-Trägern
aus Stahl verankert. Eines haben die Holzbarrieren aber in den meisten Fällen
gemeinsam, wie Glover erklärt: «Sie sind starr fundiert.»
Noch immer viele Holzbauten
Waren diese Holzpalisaden früher gegen Steinschläge noch
gang und gäbe, werden heute praktisch keine mehr gebaut. Denn vielerorts
wurden die traditionellen Schutzbauten inzwischen durch modernere Varianten mit
Stahldrahtnetzen oder Beton abgelöst. Wer die Augen nach den alten
Holzbarrieren offenhält, wird im Kanton Graubünden aber immer noch fündig, wie
Glover betont: «An alten Verkehrswegen, entlang der Bahnlinien der Rhätischen
Bahn oder auch bei Forstwegen.» Tatsächlich sind es in der Anzahl auch gar nicht
mal wenige: Reiht man alle Steinschlagschutzverbauungen im Bündnerland
aneinander, erreichen sie laut dem Forscher eine Länge von insgesamt 69
Kilometern, davon besteht ein Drittel – 20 Kilometer – noch immer aus Holz.
Verdrängt wurden die althergebrachten Schutzbauten vermehrt
ab den 1960er-Jahren, als Technologien mit Stahldrahtnetzen aufkamen. «Es
wurde viel in die Forschung und Entwicklung solcher Netze investiert»,
erläutert Glover. Dadurch konnten diese im Laufe der Zeit auch so dimensioniert
werden, dass sie höheren Aufpralllasten standhielten. Diese Arbeit kam
allerdings nicht den alten Holzpalisaden zugute. Deshalb mangelt es bis heute
an grundlegenden Daten über die Bruchschlagarbeit von Holzbalken unter dynamischen
Steinschlagbelastungen. Dadurch, aber auch durch die Dominanz der
Stahlnetzindustrie, ist die Verwendung von Holzelementen in
Steinschlagschutzbauten inzwischen praktisch obsolet geworden. Vielerorts wird
auf zertifizierte Stahldrahtnetze gesetzt.

Quelle: zvg
Eine durch Baumschlag beschädigte Holzpalisade bei Klosters: Viele dieser Bauten wurden in den 1990er-Jahren gebaut. Sie erreichen langsam aber sicher das Ende ihrer Lebensdauer.
Ersetzen oder Instandhalten?
Ein Grossteil der heute noch im Kanton Graubünden
bestehenden Holzpalisaden wurde in den 1990er-Jahren errichtet. Glover: «Im
Schnitt sollten die Bauten etwa 40 Jahre ihre Schutzleistung erbringen.»
Langsam aber sicher erreichen sie das Ende ihrer Lebensdauer. Vor diesem
Hintergrund sehen sich Behörden wie das Bündner Amt für Wald und Naturgefahren
(AWN) sowie das kantonale Tiefbauamt, aber auch Bahnunternehmen wie die
Rhätische Bahn (RhB) mit mehreren Fragen konfrontiert: Was macht man mit den
alten Holzbarrieren? Ersetzt man sie durch moderne, aber zertifizierte
Schutzbauten? Hält man sie Instand und wenn ja, wie? Muss das gesamte Holz
ersetzt werden oder nur ein oder zwei Träger?
Erste Antworten auf diese Fragen soll das Forschungsprojekt
«Holzpalisaden als Steinschlagschutz» des Instituts für Bauen im alpinen Raum
an der Fachhochschule Graubünden liefern. In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl
für Holzbau des Instituts für Baustatik und Konstruktion (IBK) der ETH Zürich
wird mit Hilfe von Steinschläge simulierenden Schlaghammerversuchen die
Wissensbasis für die Dimensionierung, Zertifizierung und Weiterentwicklung von
Steinschlagschutzbauten mit Holzelementen erarbeitet. James Glover ist
Projektleiter der Forschungsarbeit: «Grobes und langfristiges Ziel ist es, die
traditionellen Holz-Schutzverbauungen zertifizieren zu können.» Die Branche
soll damit eine umweltfreundliche Alternative zur Verwendung von
Standard-Steinschlagschutzbauten aus Stahlnetzen erhalten.

Quelle: Pascale Boschung
Statischer Versuch in Chur: Die Balken werden in einem Drei-Punkt-Biegeversuch an zwei Punkten montiert und in der Mitte langsam Schritt für Schritt einer hohen punktuellen Last ausgesetzt.
Die dynamischen Schlaghammer-Versuche an der ETH Zürich im Video. (Quelle: zvg)
3,5 Tonnen schwerer Hammer
Die dafür erforderlichen Daten werden im Rahmen der
Steinschlag-Forschung an Holzbalken gesammelt. Zum Einsatz kommen dafür
einerseits frisch geschlagene Kastanien-Rundhölzer, andererseits Balken
gleicher Holzart, die 30 Jahre lang in einem alten Steinschlagschutzbau beim
Gruobenwald ausserhalb von Klosters verbaut gewesen sind. Dieser musste
demontiert werden, nachdem eine neue Gefahrenbeurteilung – ausgelöst durch
unumgängliche Baumfällungen im alten Schutzwald – eine erhöhte
Steinschlaggefahr ergab. Dem Forschungsteam bot sich dadurch die Gelegenheit,
die Holzbarrieren genauer zu untersuchen und das darin verbaute Material
Belastungstests unterziehen zu können. Wie der Forschungsleiter erzählt, wäre
es aber fast nicht dazu gekommen: «Sie wären beinahe beseitigt worden.» Erst
auf Nachfrage konnte Glover die Bauten retten. Für die Erforschung sind die
alten Hölzer ideal; sie waren drei Jahrzehnte Wind und Wetter ausgesetzt. «Die
Fragestellung dabei ist, ob ihre Schutzleistung über die Zeit abnimmt oder nicht.»
Die Holzbalken werden im Rahmen des Forschungsprojekts zwei
Versuchen unterzogen. Im Baulabor an der FH Graubünden in Chur führt Glover mit
seinem Team statische Tests durch: Die Balken werden in einem
Drei-Punkt-Biegeversuch an zwei Punkten montiert und in der Mitte langsam einer
hohen punktuellen Last ausgesetzt. «Das entspricht dem punktuellen Lasteintrag,
den wir bei einem Steinschlag erleben». Die Maximallast wird zunächst auf Basis
einer technischen Konstruktionstabelle und anhand von Umfang, Länge und Gewicht
eines Balkens berechnet. Anschliessend wird getestet, wie viel Durchbiegung
und Last das Holz tatsächlich aushält, bis es bricht. Glover: «Die alten Träger
weisen im Vergleich zu unseren ersten Schätzungen oft eine doppelt so hohe
Bruchlast auf.» Neben dem Lasteintrag wird auch der Bruchprozess analysiert, um
am Ende die statische Bruchfestigkeit und die Versagensmechanismen der Balken
unter Stossbelastung dokumentieren zu können.
Etwas heftiger geht es an der ETH Zürich zu und her. «Hier
wird im Grunde ein Steinschlag simuliert», erklärt Glover. Dies in Form eines
3,5 Tonnen schweren Schlaghammers, der in dynamischen Pendelschlägen gegen die
Balken schwingt. Der Hammer wird dabei aus vier Metern Höhe fallen gelassen und
trifft wie ein Steinschlag mit hoher Geschwindigkeit und Kraft auf das unter
dem Pendel montierte Holz. Ohne Hindernis würde der Hammer wie ein Pendel
durchschwingen. Für die Forschung dokumentiert wird der Höhenunterschied beim
Durchschwingen, der durch den Aufprall entsteht. «Diesen nutzen wir, um die
abgegebene Energie in den Balken zu ermitteln.» Anders als beim statischen Test
wird hier der Balken in zwei Teile durchschlagen.

Quelle: zvg
Rundholz-Palisaden mit Baujahr 1995 im Sela-Wald bei Filisur: Ein grösserer Felsbrocken hatte vier runde Eichenträger der Barriere gebrochen. Die Forscher rekonstruierten das Ereignis im Labor nach.

Quelle: zvg
Anhand der Einschlagpunkte im Gelände und an Bäumen wurde die Sprungweite und daraus die Geschwindigkeit des grossen Felsbrockens bei der Holz-Palisade im Sela-Wald abgeschätzt.
Vom Feld ins Labor
Den Versuchen im Labor gingen Felduntersuchungen bestehender
Holz-Schutzbauten voraus, die Steinschlagereignisse erlebt haben. Zum Beispiel
im Sela-Wald bei Filisur. Die hier stehenden Rundholz-Palisaden mit Baujahr
1995 weisen bereits einige durch Steinschläge entstandenen Spuren auf. «Das
Gebiet ist ziemlich aktiv», so Glover. Davon zeugen nicht nur mehrere im Laufe
der Jahre festgestellten Schäden am Holz, sondern auch der angesammelte
Schotter hinter der Barriere. Im Juli 2021 stellte das Team einen heftigen
Steinschlagschaden fest: Ein grösserer Felsbrocken hatte vier runde
Eichenträger der Barriere gebrochen. Die Holzpalisade hielt den Stein aber
zurück. Glover: «Ich nutze solche Ereignisse, um die mögliche Bruchkraft zu
ermitteln.»
Der Stein wurde vor Ort 3D-gescannt und die Umgebung
analysiert, um den genauen Fall des Brockens nachzukonstruieren. Danach ging es
vom Feld ins Labor. Anhand der Einschlagpunkte im Gelände und an Bäumen wurde
die Sprungweite ermittelt und daraus die Geschwindigkeit des Steins
abgeschätzt. «Daraus haben wir beim Einschlag eine Geschwindigkeit von etwa 14
Metern pro Sekunde mit einem 800 Kilogramm schweren Stein berechnet.» Damit
liege man in einem Bereich von 100 Kilojoule – das entspricht einem Kleinwagen,
der mit rund 50 km/h
ungebremst in eine Wand fährt. Die Schutzleistung der Holzzäune wird derzeit aber sehr viel tiefer eingeschätzt: In einer Grafik vom Bundesamt für Umwelt
(Bafu) zu Schutzbauwerken gegen Massenbewegungsgefahren werden Holz-Wände im untersten Bereich zwischen 30 bis 50 Kilojoule aufgeführt.
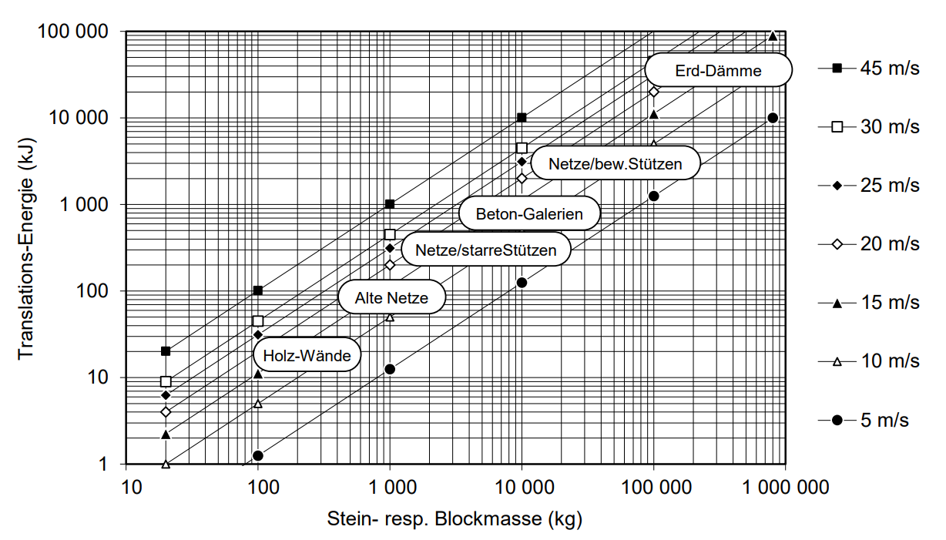
Quelle: BAFU 2016, Schutz vor Massenbewegungsgefahren
In einer Grafik vom Bundesamt für Umwelt zu Schutzbauwerken gegen Massenbewegungsgefahren von 2016 werden Holz-Wände im untersten Bereich zwischen 30 bis 50 Kilojoule aufgeführt.
Genau hier setzt nun aber das Forschungsprojekt an. Mit den
erarbeiteten Daten und Bemessungsgrundlagen könne man in Zukunft bestimmen, ob
die Bauweise tatsächlich in einem Steinschlaggebiet mit 100 Kilojoule
eingesetzt werden könnte. «Dann werden solche Holzschutzzäune eine Option für
die Behörden.» Davon abgesehen werden diese aber auch nach einer Zertifizierung
nicht überall flächendeckend eingesetzt werden können. Denn Stahllösungen
dürften hinsichtlich der Schutzleistung gegen Steinschlag auch in Zukunft die
Nase vorne haben: «Die neusten Stahldrahtnetze mit Bremselementen können mittlerweile bis zu 12'500 Kilojoule stoppen.»
Mögliche Einsatzgebiete für die althergebrachte Methode mit
Holzelementen wären für Glover aber zum Beispiel Wälder, die an sich bereits
einen wirksamen Schutz gegen Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag,
Rutschungen und Murgänge bieten. «Ergänzt um Holzbarrieren könnten diese
Schutzwälder gut wachsen.» Zudem würde ihre Schutzwirkung damit zusätzlich
verstärkt.
Nachhaltige Alternative
Die traditionelle Baumethode mit Holzelementen wäre auch
eine nachhaltige Alternative. Denn Steinschlagschutzbauten aus Stahl weisen
einen vergleichsweise hohen CO2-Fussabdruck auf und werden zusätzlich mit für
die Umwelt schädlichen Zinkbeschichtungen vor Korrosion geschützt.
«Nachhaltigkeit ist ein wachsendes Thema in der Baubranche», sagt Glover. Zudem
haben das Amt für Wald und Naturgefahren sowie das Tiefbauamt und die RhB
Interesse am Projekt bekundet. Abgesehen von der Nachhaltigkeit könne die traditionelle
Bauweise aber auch wirtschaftliche Vorteile bieten. «In der Schweiz wird
relativ viel Geld in den Naturgefahrenschutz investiert.» Das gilt aber nicht
für internationale Strassenwege über Berggebiete wie in Nepal, im Himalaya,
Afghanistan oder Tadschikistan. «Die Holzpalisaden könnten hierbei eine
günstige Variante darstellen».
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Zunächst soll ein
Leitfaden zur Bemessung von Holzpalisaden erstellt werden. Für die Zukunft hat
sich das Forschungsteam noch weitere Ziele gesteckt, darunter die Erarbeitung
eines Leitfadens zur Überprüfung und Instandhaltung bestehender Holzpalisaden
oder die Verbesserung der starren Bauweise. Aber auch eine Ertüchtigung der
Bauten – etwa durch die Einführung von Bremselementen, Gelenkstutzen oder einem
Verspann-Netz. Und das langfristige Ziel ist natürlich die Entwicklung eines
Verfahrens zur Zertifizierung. «Das kommt aber alles in einer nächsten Phase»,
lacht Glover. Die jetzige Forschung liefere dazu die Informationen und
Grundlagen. Damit könnte es im Gruobenwald bei Klosters vielleicht irgendwann
auch wieder Holzzäune geben – an ihrer Stelle stehen dort heute nämlich
Stahldrahtnetze.
Projektbeteiligte
Lead: Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR), FH Graubünden
Projektleitung: James Glover
Team: Yasin Akkus, Philip Crivelli, Imad Lifa, Dionysios
Stathas
ETH Zürich:
Lehrstuhl für Holzbau
Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK), ETH Zürich
Experimentelle Forschung (expRES@IBK)
Alex Sixie Cao
Gioele Montalbetti
Andrea Frangi






