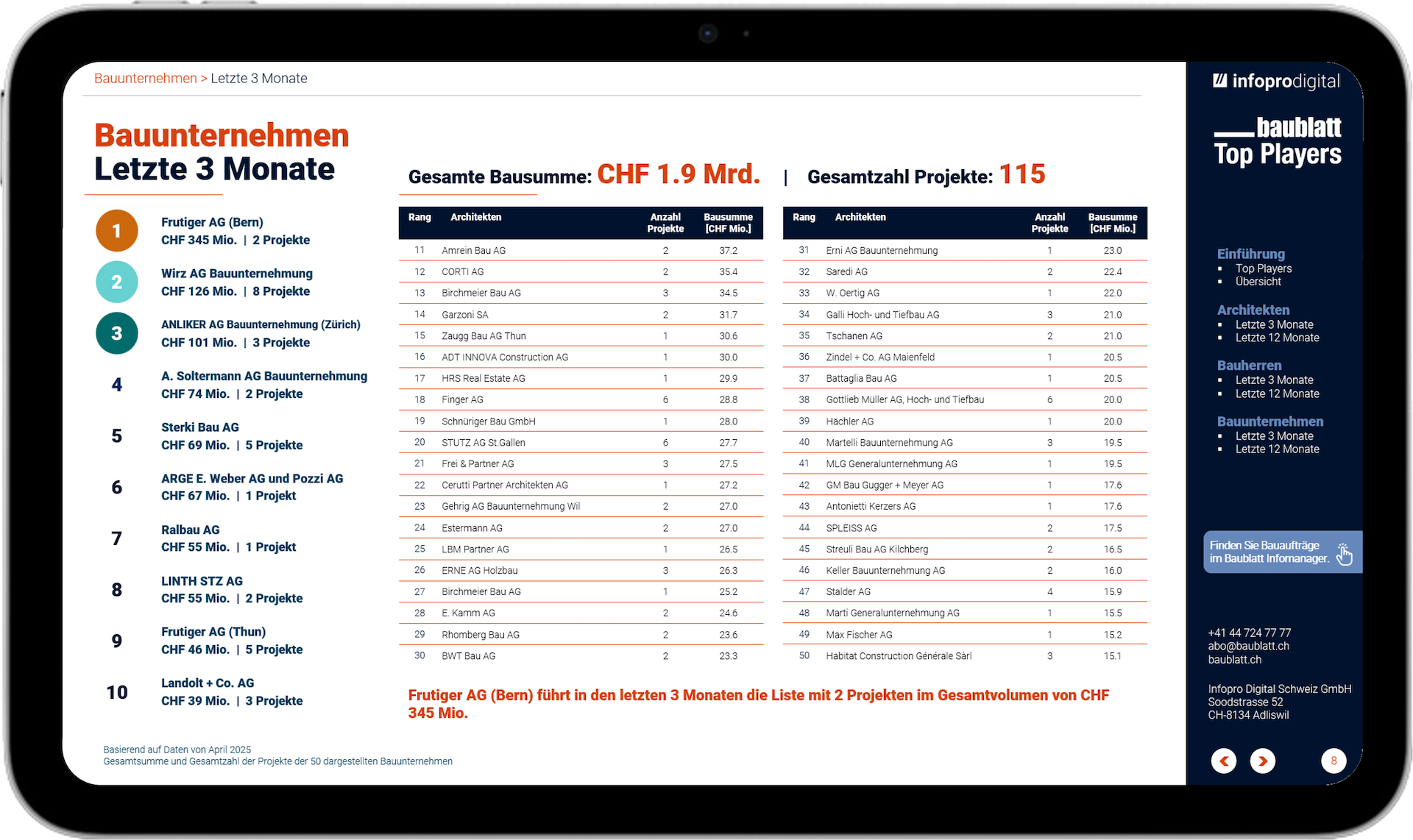Energieversorgung: Wie abgelegene Gebiete zu einem Stromnetz kommen
Wie viel Strom Menschen in abgelegenen Dörfern in Kenia oder Guatemala brauchen, wollte eine Wissenschaftlerin der ETH und Empa wissen. Demnächst stellt sie das neuartige Computermodell vor, das massgeschneiderte Lösungen zur Stromversorgung für die Ärmsten ermöglichen könnte. Neben der Technik spielen beim neuen Ansatz auch soziale und politische Faktoren eine Rolle.

Quelle: Cristina Dominguez / ETH Zürich
Off-Grid-Systeme sind eine vielversprechende Lösung, um abgelegenen Dörfern in Entwicklungsländern wie Kenia den Zugang zu Strom zu ermöglichen.
Schalter ein: Licht an. Schalter aus: dunkel. In der Schweiz lernt jedes Kind dieses Konzept in den ersten Lebensjahren kennen und schätzen. Manchmal ist es ja auch ein ganz witzig – ein, aus, ein, aus. Hauptsache die Eltern sind genervt. Die Selbstverständlichkeit eines Lichtschalters ist aber längst nicht aller Menschen Realität. 90 Prozent der Weltbevölkerung hatten 2019 laut Berechnungen der International Energy Agency (IEA) zwar Zugang zu Elektrizität. Doch knapp 760 Millionen Menschen leben weiterhin ohne Strom. Rund 75 Prozent der Menschen ohne Anschluss an ein Stromnetz leben in der Subsahara Afrikas.
Fehlender Zugang zu Elektrizität steht in direkter Verbindung zu Armut und Gefahren für die Gesundheit, wie zum Beispiel durch rauchende Feuerstellen und Kerosinlampen im Haus. Deshalb ist der Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie auch eines der 17 «Sustainable Development Goals» (SDG 7) der «Agenda 2030», in der die politischen Ziele der Vereinten Nationen für die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung definiert sind.
Die Pandemie hat die Fortschritte der vorangegangenen Jahre allerdings verlangsamt. Die Zahlen der Menschen ohne Stromzugang in Afrika sind gemäss dem diesjährigen SDG-Bericht der UNO im 2020 wieder gestiegen. Beim derzeitigen Tempo des Ausbaus geht die UNO sogar davon aus, dass 2030 immer noch 660 Millionen Menschen ohne Strom auskommen müssen.

Quelle: Cristina Dominguez / ETH Zürich
Ein kenianischer Teamkollege befragt eine Dorfbewohnerin zu ihrem Energiebedarf. Soziale, politische, finanzielle und viele weitere Faktoren spielen dabei eine Rolle.
Während sich Dominguez im Studium in Guatemala, Madrid und Nantes mehr mit der Energieversorgung beschäftigte, verschob sie für die Doktorarbeit den Blick auf die Bedarfsseite. Sie wollte herausfinden, wie viel Energie Menschen benötigen und welche Faktoren ihren Energiebedarf beeinflussen. Denn Elektrifizierungsprojekte in ländlichen Regionen stehen häufig vor dem Problem, dass der Energiebedarf basierend auf allgemeinen Annahmen berechnet wird. «Das sind Annahmen, die teilweise nicht einmal landesspezifisch angepasst sind. Sie gehen einfach davon aus, dass das, was für Indien gilt, auch in afrikanischen Ländern funktioniert», gibt die Wissenschaftlerin zu Bedenken.
So kommt es zum Bau von falsch dimensionierten Stromnetzen. Das belastet sowohl die Projektentwickler als auch die Bevölkerung, die sich den zu teuren Strom danach nicht leisten kann. «Sogenannte Mini-Grids, die unabhängig vom nationalen Stromnetz laufen, oder Off-Grid-Lösungen, wie eine Solaranlage für ein Dorf, sind ein vielversprechendes Angebot. Aber dafür braucht man exakte Nutzungsdaten.» Das Ziel müsse ein massgeschneidertes Stromnetz sein, das den tatsächlichen Bedarf der Bevölkerung decke und für Projektentwickler eine attraktive Investition sei. «Der Strombedarf ist nicht bloss eine rein rechnerische Angelegenheit. Vielmehr spielen soziale, politische, finanzielle und viele weitere Faktoren hinein», weiss Dominguez. Diese musste sie für ihr geplantes Computermodell näher erforschen.
Feldforschung in Kenia
Schon von Beginn weg stand Dominguez eine Menge an Datensätzen für ihre Forschungsarbeit zur Verfügung. Viele Organisationen und Institutionen erheben regelmässig Informationen zum Elektrifizierungsfortschritt oder zum Energiebedarf in Entwicklungsländern. «Häufig fehlen aber die Informationen aus ländlichen Gegenden in diesen Erhebungen», so Dominguez. Ihr Stromverbrauchs-Modell sollte am Ende verlässlich voraussagen, wie viel Energie ein Haushalt je nach Region zu unterschiedlichen Tageszeiten brauchen würde. Dafür reichten die bestehenden Daten nicht. Eine Feldforschung war angesagt. Einerseits, um weitere Informationen zu sammeln, andererseits um zu überprüfen, ob das bis dahin erstellte Modell den realen Gegebenheiten standhalten würde.
Mit der Unterstützung von vier ortsansässigen Forschungsassistenten besuchte Dominguez Ende 2019 im ostafrikanischen Kenia in 17 Dörfern insgesamt 250 Haushalte. Mit «Tür-zu-Tür-Befragungen» untersuchte sie ihren Energiebedarf. Die eine Hälfte der Dörfer war in den letzten sechs Jahren an ein Stromnetz angeschlossen worden, die andere Hälfte hatte noch keinen Zugang. «Unser Ziel war es, die Lücken in den bestehenden Daten von anderen Organisationen zu füllen.» Gleichzeitig führten sie Messungen in den am Strom angeschlossenen Dörfern durch. Dafür installierten sie Strommesszangen, die den Stromverbrauch während einer Woche aufzeichneten.

Quelle: Cristina Dominguez / ETH Zürich
Je nach Bauweise brauchen die Bewohnerinnen und Bewohner im Innern der Hütten auch tagsüber Lichtquellen wie bei diesem Haus im Osten Kenias.
Haushalt mit mehreren Hütten
Die wichtigsten Fragen, die das Team um Dominguez den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern stellten, drehten sich um die vorhandenen elektrischen Geräte und das Nutzungsverhalten. «Um die Stromnutzung abschätzen zu können, muss ich wissen, wie und zu welchen Tageszeiten sie ihre elektrischen Geräte wie Lampen, den Kühlschrank oder das Radio nutzen.» Je nach Bauart des Hauses und den verwendeten Materialien sowie der Isolation oder dem Lichteinfall würden Geräte unterschiedlich genutzt.
Und es galt, Antworten auf weitere Fragen zu finden. Wie verhalten sich die Familienmitglieder? Zu welchen Tageszeiten halten sie sich wo auf? Wie interagieren sie miteinander und wer beeinflusst wessen Verhalten? Halten sich die Personen separat in einzelnen Räumen auf, wird beispielsweise Licht anders genutzt als in der Gruppe. «Menschliches Verhalten vorauszusagen ist sehr komplex», sagt Dominguez. Umso wichtiger war die Befragung vor Ort.
Etwas ist der Wissenschaftlerin bei der Feldforschung besonders aufgefallen: «Das Konzept von Räumen in einem Haushalt wird in den untersuchten Dörfern ganz anders gelebt.» Sie verweist auf Ansammlungen kleiner Gebäude, die jeweils nur aus einem Raum bestehen, genannt Bomas, und als einzelne Zimmer genutzt werden. «Sie sind aber Teil eines Haushalts, der aus den verschiedenen Hütten besteht.» Hätten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur Satellitenbilder des Dorfes angesehen, wären sie nie darauf gekommen.
Weiter zeigten die Befragungen, dass in einigen Dörfern, die keinen Zugang zu Elektrizität haben, kleine Solarlampen zur Anwendung kommen. «Manchmal ist die Solarlampe auch mehr als nur eine Lichtquelle. Das Gerät ist dann zum Beispiel Lampe und Radio in einem.» Generatoren hingegen seien unüblich in dieser Gegend. Gleichzeitig beobachtete sie, dass vereinzelt Dorfbewohner deutlich mehr Geräte besassen als sie beispielsweise mit ihrem kleinen Solarpanel betreiben konnten. «Ein Wohnzimmer mit grossem Fernseher und Soundanlage, aber ohne genügend Strom, um diese zu nutzen, hat mich besonders erstaunt.»
Strom verändert das Verhalten
Anhand der Dörfer, die bereits Stromzugang hatten, konnte Dominguez unter anderem die so genannten «Post-Electrification Patterns» erforschen, die das Verhalten der Menschen nach dem Anschluss ans Stromnetz beschreiben. «Viele Projekte sind in der Vergangenheit gescheitert, weil Menschen viel mehr oder viel weniger Strom als erwartet konsumierten.»
Die Verhaltensmuster nach der Elektrifizierung zeigten, dass im ersten Jahr viele neue Geräte gekauft würden, auch wenn nicht viel Geld vorhanden sei. Im zweiten Jahr flacht der Konsum ab, wenn die Menschen realisieren, was die Energie kostet. «Ab dem dritten Jahr gibt es einen erneuten Peak. Die Bewohnerinnen und Bewohner kaufen effizientere Geräte und sehen gleichzeitig erste Ersparnisse, weil sie auf teure fossile Brennstoffe verzichten.»
Mit Algorithmen zum Modell
Zurück in Zürich baute Dominguez die gewonnenen Erkenntnisse in ihre Computer-Modelle ein. Diese beinhalteten schon eine grosse Menge an Daten – von Klimadaten über Satellitenbilder, Baumaterialen, fossile Energiequellen bis hin zu demografischen Daten. Diese konnte sie nun mit dem erhobenen Nutzungsverhalten anreichern und abgleichen.
In Kurzform erklärt, wandte die Wissenschaftlerin zunächst Cluster-Algorithmen zur Gruppierung der Familienmitglieder und ihrer Aktivitäten an. Dann setzte sie einen Algorithmus ein, der voraussagt, was die in verschiedene Cluster eingeteilten Personen zu bestimmten Tageszeiten tun. Anschliessend modellierte sie die Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern. Auf Basis sämtlicher erfasster Daten ist das Modell schliesslich in der Lage, die Gerätenutzung und damit den Strombedarf eines Haushalts zu berechnen. Die 30-Jährige fasst zusammen: «Ich arbeite mit einer breiten Datenbasis und wende darauf Machine Learning, also Algorithmen, an. Wichtig ist dabei vor allem, die Daten richtig vorzubereiten und korrekt einzubauen.» Gleichzeitig validierte Dominguez das Modell mit vorhandenen Daten aus anderen Projekten auch für Guatemala und Pakistan.
Das Resultat ist ein «Framework», das weltweit Anwendung finden und den Strombedarf jeder Region berechnen könnte, solange die richtigen Daten für den jeweiligen Standort korrekt eingegeben werden. «Für neun afrikanische Länder sind sämtliche Daten bereits eingebaut, sodass Projektentwickler nur noch die Region eingeben und die Zahlen auslesen müssen.» Für alle anderen Länder bräuchten Projektentwickler weitere spezifische Daten, etwa für einzelne Regionen. Allerdings sind für die Berechnung nur öffentlich zugängliche Daten nötig, die problemlos beschafft werden könnten, betont Dominguez. Im Dezember wird sie ihre Resultate präsentieren und für alle frei zugänglich veröffentlichen.

Quelle: Cristina Dominguez / ETH Zürich
Bei den Besuchen in 17 ostkenianischen Dörfern zeigte es sich, dass ein Haushalt nicht selten auf mehrere Gebäude verteilt ist. So genannte Bomas umfassen jeweils nur einen Raum.
Workshops in Guatemala
Neben ihrer Doktorarbeit erhielt Dominguez in einer Kollaboration von Empa, Helvetas und ETH Zürich sowie der Universidad del Valle de Guatemala die Möglichkeit, ihre Forschung in ihrem Heimatland anzuwenden. Finanziert wurde das Vorhaben übrigens vom Centro Latinoamericano-Suizo der Hochschule St. Gallen (HSG). In diesem Projekt kombiniert sie ihr «Framework» mit einem anderen Modell für die Planung eines auf die konkreten Gegebenheiten angepassten Mini-Grids.
Im Unterschied zu den Untersuchungen in Kenia führten die beteiligten Wissenschaftler in diesem Projekt nicht nur Haushalts-Befragungen durch, sondern sie schufen mit «Community Workshops» auch Raum für Sensibilisierungsarbeit und Erfahrungsaustausch (siehe Box «Energiewende und die Rolle der Frauen»). «Hier wollten wir neben der Datensammlung auch tiefer in die Details gehen, den Dorfbewohnern unsere Messungen zeigen und im Gespräch zum Beispiel herausfinden, welche konkreten Aktivitäten jeweils zu höherem Stromverbrauch geführt haben könnten.» Derzeit läuft das Projekt noch, die Resultate sollen 2022 publiziert werden.
Diese Herausforderung packt die 30-Jährige mit dem klangvollen Namen Cristina de los Angeles Dominguez Hernández an. Die Wissenschaftlerin aus Guatemala forscht an computerbasierten Modellen, mit denen Stromnetze in Entwicklungsländern genauer geplant und umgesetzt werden können. Nach bald vier Jahren schliesst sie ihre Doktorarbeit am Institut für Bauphysik der ETH Zürich und beim Urban Energy Systems Lab der Empa ab.
Stromnetze auf Mass sind gefragt
«In Europa entwickelte sich der Ausbau der Stromnetze überall etwa zeitgleich. In Entwicklungsländern verläuft dieser Prozess ganz anders. So sehen wir heute riesige Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen, sowohl in der Stromversorgung als auch in der Armut», erklärt Dominguez. Viele Faktoren beeinflussen diesen «Gap», das beobachtet die Forscherin auch in ihrer eigenen Heimat Guatemala. Und genau das treibt Dominguez an: «Ich will Themen erforschen, die ich in meiner Heimat anwenden kann. Ich möchte Wege und Lösungen finden, um die Lebensqualität in ländlichen Regionen in Entwicklungsländern zu erhöhen.»
Energiewende und die Rolle der Frauen
Eine Beobachtung, welche die Wissenschaftlerin Cristina Dominguez sowohl in Kenia als auch in Guatemala gemacht hatte, führte sie in ein etwas anderes Gebiet: Die Rolle der Frauen in der Energiewende. «Diejenigen, die sich in Guatemala am meisten für das Thema der Energieeffizienz interessierten, waren die Frauen. Das deckte sich mit meinen Erfahrungen in Kenia. Auch dort waren es die Frauen, die den gewohnten Brennstoffen wie Kerosin am schnellsten den Rücken kehrten, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten», berichtet Dominguez. Frauen, die Zugang zu Strom erhalten hätten, zum Beispiel als Lichtquelle, seien auch bei anderen Geräten und Aktivitäten, wie etwa beim Kochen, schneller auf Strom umgestiegen. Die Befragung zeigte, dass sie mehr Zeit im Haus verbringen und dadurch den gesundheitsschädlichen Emissionen stärker ausgesetzt sind. «Ausserdem investieren Frauen viel mehr Zeit ihres Tages in die Beschaffung von Brennstoffen und das Sammeln von Feuerholz.» (nsi)