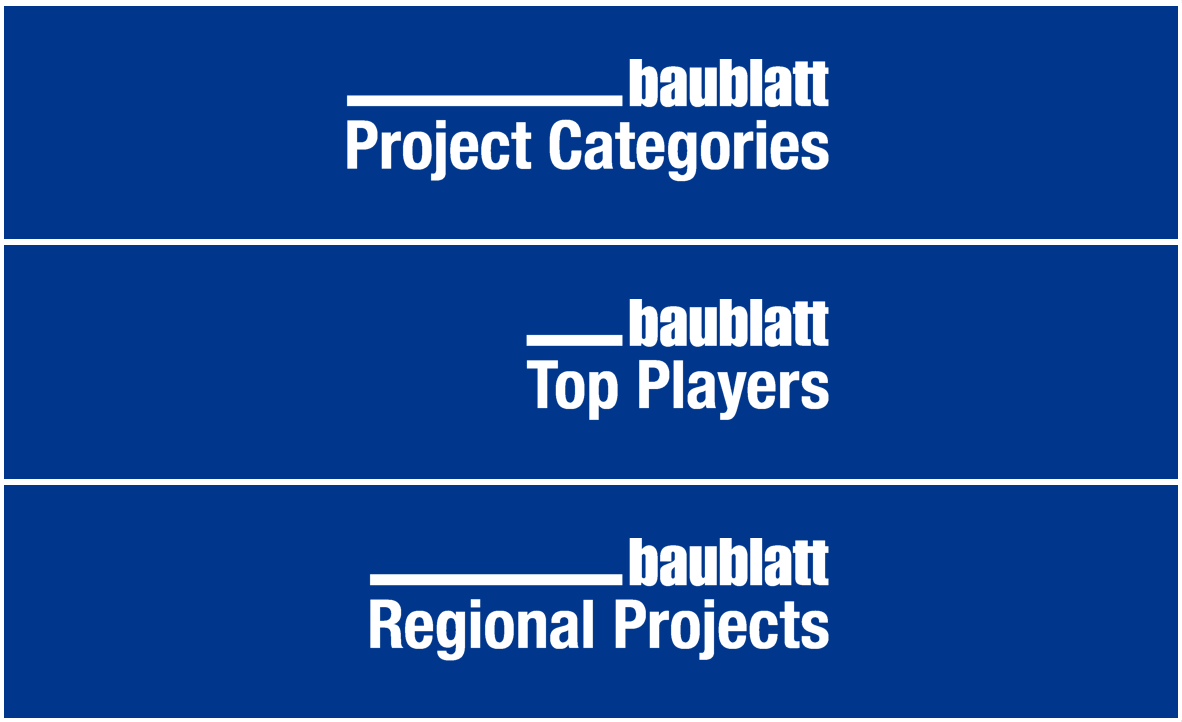Wohnungsnot in Graubünden: Kanton spielt Ball den Gemeinden zu
Wohnraum für Einheimische ist in vielen Bündner Regionen zunehmend knapp oder kaum noch erschwinglich. Die Regierung ist sich des Problems bewusst, will aber selber nicht handeln. Sie sieht die Gemeinden in der Pflicht, das Problem anzugehen.

Quelle: PxHere, gemeinfrei
Blick auf die Stadt Chur. (Symbolbild)
Die Exekutive ist der Ansicht, «dass auf kantonaler Ebene derzeit keine weiteren Massnahmen zu ergreifen sind.» Dies schrieb sie in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage aus dem Parlament. «Viele wirkungsvolle Massnahmen» seien «primär auf kommunaler Ebene umzusetzen». Zudem zeige sich die Problematik regional unterschiedlich – je nachdem, ob es sich um Agglomerationen, Tourismusorte oder Täler mit Abwanderung handle.
Eine zentrale Rolle sieht die Regierung in der Raumplanung. Der Ball liege bei den Gemeinden. Mit ortsplanerischen Massnahmen könnten die Kommunen «gezielt und massgeschneidert» Einfluss auf den Wohnungsbau nehmen. Laut der Exekutive sind noch viele ungenutzte Bauzonenreserven vorhanden. Gemeinden könnten sie mobilisieren und so die Wohnbautätigkeit fördern. Stünden keine Reserven zur Verfügung, seien Neueinzonungen denkbar.
Mit einer aktiven Bodenpolitik könnten die Kommunen zudem preisgünstigen Wohnraum für bestimmte Zielgruppen realisieren. «Bei Ein-, Um- oder Aufzonungen können Vorgaben bezüglich erschwinglichen Wohnraums in der Ortsplanung verankert werden», betonte die Regierung.
Rapide Abnahme verfügbarer Wohnungen
Dass es in Graubünden für Einheimische immer schwieriger wird, erschwinglichen Wohnraum zu finden, ist in Graubünden unbestritten. Zahlen des Bundesamtes für Statistik stützen den Befund.
Die – ohnehin schon unterdurchschnittliche – Zahl verfügbarer Wohnungen im Bündnerland ging von Mitte 2020 bis Mitte 2021 um ganze 37 Prozent zurück. Anfang Juni 2021 lag die Leerwohnungsziffer bei gerade mal 0,87 Prozent. Nur Zug, Genf und Zürich hatten zu diesem Zeitpunkt noch tiefere Leerwohnungsanteile. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor.
Als Grund für die Wohnungsnot wird in Graubünden regelmässig – wie jetzt in der parlamentarischen Anfrage – die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative an erster Stelle genannt. Sogenannte «altrechtliche» Wohnungen – solche, die vor der Annahme der Initiative an der Urne im Jahr 2012 gebaut wurden – dürfen weiterhin zu Ferienwohnungen umgenutzt werden.
In Tourismusorten, wo wegen der Initiative keine Ferienwohnungen mehr gebaut werden dürfen, ist die Umnutzung die einzige Möglichkeit, den Zweitwohnungsmarkt zu bedienen. Im Gegenzug verschwinden diese älteren Wohnungen vom Erstwohnungsmarkt.
Zweitwohnungsinitiative nicht Hauptgrund
Die Bündner Regierung verweist nun darauf, dass die freie Nutzbarkeit altrechtlicher Wohnungen «weder die einzige noch die hauptsächliche Ursache für die Problematik ist.» Auch in Gemeinden, welche die Zweitwohnungsinitiative nicht tangiere, sei Wohnraum knapp oder teuer oder auch beides.
Darum spricht sich die Exekutive dagegen aus, die Wohnungsnot mit Einschränkungen für altrechtliche Wohnungen anzugehen. Solche Eingriffe wären zudem rechtlich heikel und «kaum befriedigend umsetzbar».
Pandemie und Homeoffice als weitere Faktoren
Welche anderen Faktoren die Wohnungsknappheit mitverursachen, erläutert die Regierung in ihrer Antwort nicht. Regierungsrat Marcus Caduff (Mitte) äusserte sich dazu aber bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Interview mit der Regionalzeitung «Engadiner Post». Der Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales nannte nebst der Zweitwohnungsinitiative vier weitere Auslöser.
So habe die Corona-Pandemie die Problematik in mehreren Regionen verstärkt. Die forcierten neuen Arbeits- und Lebensmodelle – Stichwort Homeoffice – hätten viele zu einer Verlagerung des Hauptwohnsitzes in die Berge bewegt. Der Wunsch, sich in den Bergen aufzuhalten, habe den Wohnungsmarkt «sehr ausgetrocknet», erklärte Caduff.
Weiter fordere das revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz die Reduktion überdimensionierter Bauzonen. Zudem steigere ein tiefes Zinsumfeld die Attraktivität von Investitionen in Immobilien. Die Verknappung des Baulandes bei grosser Nachfrage führe zu höheren Preisen.
Umgekehrt sei es in peripheren Talschaften mit Bevölkerungsabwanderung für Investoren nicht attraktiv, sich im Erstwohnungsbau zu betätigen. (sda/pb)