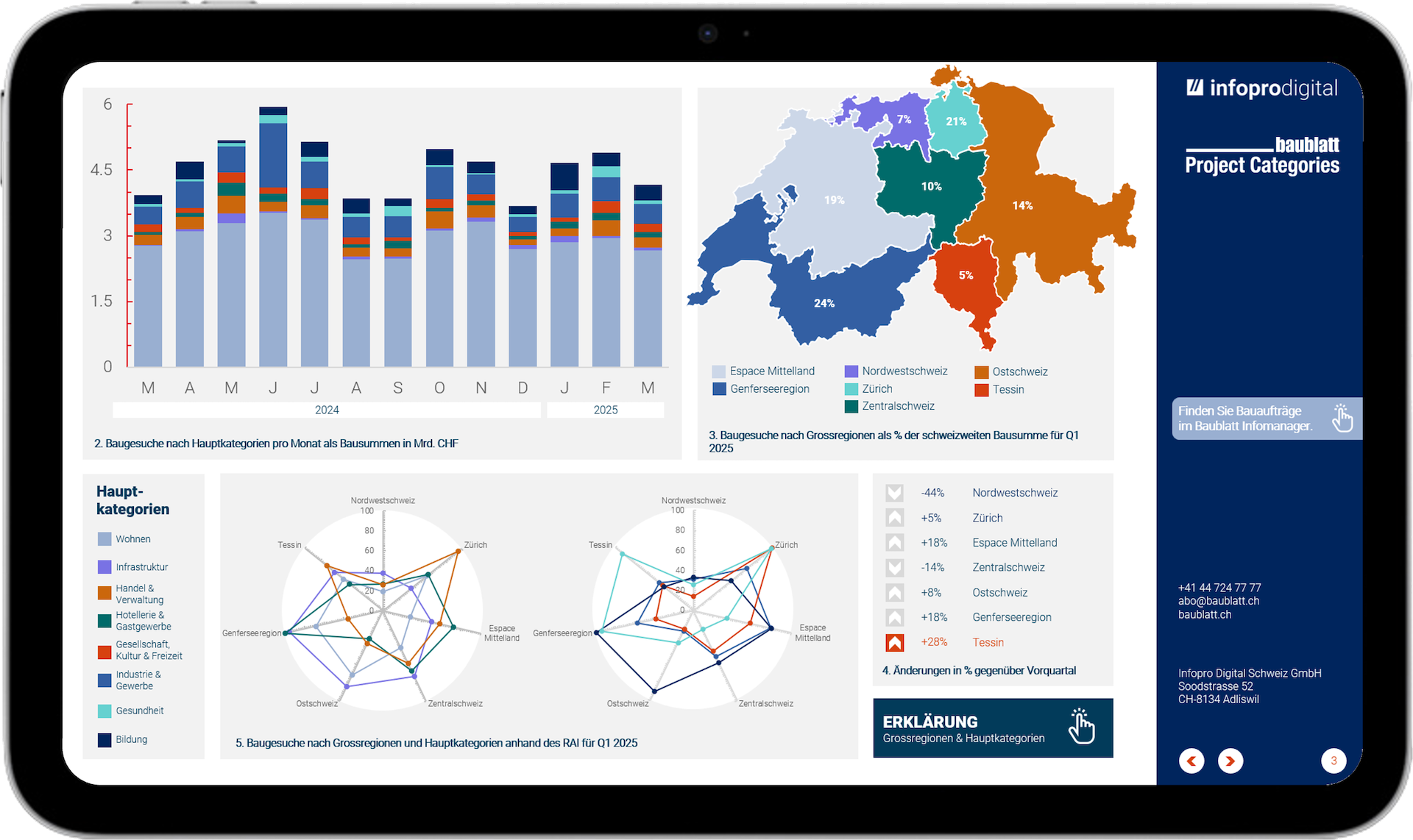Jahresendanalyse: Solides Wachstum bei konjunkturellen Risiken
Die Schweizer Baubranche kann im zweiten Coronajahr ein gutes Fundament legen für die künftige Hochbautätigkeit. Der Wohnbau bleibt die Stütze der Baukonjunktur. Die Industrie will kräftig in Produktionsgebäude investieren, die öffentliche Hand plant hohe Summen für den Bau von Schulen und Spitälern. Sorgen bereitet der Bürobau. Für die Volkswirtschaften wird die Inflation zum Risiko.
Im unsicheren Umfeld der Pandemie kann das Schweizer
Bauhaupt- und Ausbaugewerbe ein stabiles Fundament schaffen für die künftige
Hochbautätigkeit. Die anhand von Gesuchen ermittelte Bausumme erhöhte sich in
den ersten elf Monaten im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 11,6
Prozent. Unter Einbezug des Dezemberwerts auf Basis hochgerechneter Daten
dürfte das Wachstum der Hochbausumme per Ende Jahr gesamthaft wegen des
rückläufigen Schlussmonats allerdings tiefer ausfallen.
Als wichtigste Stütze der künftigen Baukonjunktur wird sich der Wohnbau erweisen. Die im Jahr aufgelaufene Summe für geplante Bauprojekte (Year to Date – YTD) verzeichnete per Ende November gegenüber der Vorjahresperiode gesamthaft ein Plus von 9,9 Prozent. Nach einer zaghaften Entwicklung der Summe projektierter Mehrfamilienhäuser (MFH) in der ersten Jahreshälfte legten die Investoren ihre Zurückhaltung ab, sodass das Segment im Vergleich zum Vorjahr eine Wachstumsrate von 7,3 Prozent ausweisen konnte.

Quelle: Stefan Schmid
Die Beatles erschlossen mit der Technik von Studer Revox neue Hörerlebnisse. Nach dem Rückbau des Firmengebäudes in Regensdorf (Bild) lebt der Mythos weiter – wie der Name vieler Bands.
Die Produktion von Mietwohnungen stagnierte in den letzten
zwei Jahren, oder sie war sogar rückläufig. Auch wurden laut den
Immobilienexperten der Credit Suisse bereits 2019 deutlich weniger
Mietwohnungen baubewilligt als in den drei Jahren davor. Ein Teil der Wohnungen
wurde sodann von der im Coronajahr vergleichsweise hohen Zuwanderung
absorbiert. Zudem verblieb die Mieterschaft während der Pandemie vermehrt in
den angestammten Wohnungen.
Mehr An- und Umbauten geplant
Die Verknappung des Angebots führte zu einem Abbau der Leerstände.
Die Leerwohnungsquote sank dieses Jahr schweizweit auf 1,54 von zuvor 1,72
Prozent. Wohnungssuchende mussten in der Folge wegen steigender Mieten erneut
tiefer in die Tasche greifen. Die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten sind im
November durchschnittlich um 1,5 Prozent gestiegen, wie der von «Immo Scout 24»
in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen Iazi erhobene Swiss
Real Estate Offer Index ermittelte. Über die letzten zwölf Monate betrug die
Veränderung 1,0 Prozent.
Geplant sind bei Mehrfamilienhäusern auch deutlich mehr An- und Umbauten oder Kombinationen von beiden. Die YTD-Summe fürs Bauen im Bestand legte gegenüber dem Vorjahr um 15,7 Prozent zu, wie aus Zahlen der Docu Media Schweiz GmbH zu den Baugesuchen hervorgeht.
Nach wie vor konkurrieren Bauherren von Eigentumswohnungen
mit den Investoren im Mietwohnungssegment um das knappe Bauland. Auf
Jahresbasis stiegen laut Iazi und «Immo Scout 24» die Preise im dritten Quartal
um 5,1 Prozent, es ist das höchste Jahreswachstum seit 2014. Neben dem
Engagement von institutionellen Anlegern beobachtet Iazi-Chef Donato
Scognamiglio bei Renditeobjekten vermehrt auch Aktivitäten privater Investoren.
Bei sehr niedrigen Renditen sei dies für Private allerdings mit hohen Risiken
verbunden, beurteilt er die Situation kritisch. Auf Jahresbasis hätten sich die
Transaktionspreise für Mehrfamilienhäuser mit 4,5 Prozent deutlich erhöht.
Kleine Verschnaufpause bei Einfamilienhäusern
Die Angebotspreise für Einfamilienhäuser (EFH) erhöhten sich im November gegenüber dem Vormonat weiter. Gemäss den von «Immo Scout 24» und Iazi erstellten Statistiken resultierte im 3. Quartal auf Jahresbasis ein Wachstum von 5,8 Prozent. Die geplante Summe für den Bau von Einfamilienhäusern (EFH) kann zwar noch eindrückliche Wachstumsraten ausweisen. Trotz des Preiswachstums dürfte sich die Lage auf dem boomenden EFH-Markt nur vorübergehend entspannen, denn bis Oktober gingen die Projektsummen von den Höchstständen Mitte des Jahres kontinuierlich zurück. Gleichwohl wies das Segment im Vergleich zum Vorjahr gesamthaft eine deutlich höhere Bausumme aus (YTD: +17,6 %).
Die Preissteigerungen bei Wohnimmobilien sind allerdings kein Schweizer Phänomen. Gemäss Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) übertraf der Preisanstieg in den USA, Kanada und Schweden in den letzten zwölf Monaten die Marke von 15 Prozent. In Österreich wurden Häuser in dieser Zeit um 11,7 und in Deutschland um 10,9 Prozent teurer.

Quelle: Stefan Schmid
Ein hohes Investitionsvolumen fliesst nach wie vor in den Wohnbau. Stabil ist das Wachstum der geplanten Summe für den Bau von Mehrfamilienhäusern. Bild: Überbauung in der Nähe des Letzigrund-Stadions.
Bauland treibt Preise
Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet sind die Preise für Wohnimmobilien deutlich gestiegen. In den letzten zehn Jahren erhöhten sich die Transaktionspreise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser schweizweit um etwa 50 Prozent, wie die Indizes der Raiffeisenbank zeigen. Zwar seien die Preisschübe bei den Renditeliegenschaften auch auf den nach wie vor herrschenden Anlagenotstand zurückzuführen. Doch der grösste Teil des Anstiegs lasse sich mit der Preisentwicklung des Landanteils erklären.
Der durchschnittliche
Preis pro Quadratmeter Bauland für Wohnbauten ist laut der Analyse der Bank
beispielsweise im Kanton Basel-Landschaft in den letzten zehn Jahren um fast 55
Prozent gestiegen. Dagegen hätten sich die Erstellungskosten der bestehenden
Schweizer Wohngebäude kaum verändert. So koste der Bau eines Einfamilienhauses
im Vergleich zu 2010 heute nur etwas über drei Prozent mehr. Damit ist fast die
gesamte Preissteigerung auf den höheren Landpreis zurückzuführen, wie die Bank
in der Analyse ausführt. Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff fordert daher, dass
in Städten und Agglomerationen neues Bauland erschlossen und dort auch dichter
gebaut werden sollte.
Industrie investiert kräftig
Bisher konnte der Industriebau von der raschen Erholung profitieren, wobei das Segment den Aufwärtstrend der Gesamtwirtschaft nachzeichnet. Die Bausumme konnte in den letzten drei Quartalen gegenüber der jeweiligen Vorperiode mit zweistelligen Wachstumsraten zulegen, allerdings teilweise bedingt durch Basiseffekte. Die anhand von Gesuchen ermittelte Bausumme für Erweiterungen des Gebäudeparks von Industrieunternehmen und Gewerbebetrieben erhöhte sich per Ende November im Vergleich zum Vorjahr um 26,9 Prozent (YTD). Die überdurchschnittlich hohen Investitionen spiegelt auch die Zuversicht der Branche wider.
Denn für die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) lief es in diesem Jahr wieder besser. Der Branchenverband Swissmem meldete in den ersten neun Monaten bei den Auftragseingängen im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 30,6 Prozent, die Umsätze nahmen im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls zweistellig zu. Die Auslastung der Kapazitäten lag im dritten Quartal mit 87,2 Prozent sogar über dem langjährigen Mittel von 86,1 Prozent. Und 49 Prozent der MEM-Unternehmen rechnen laut Umfrage in den kommenden zwölf Monaten mit einem gleichbleibenden Auftragseingang aus dem Ausland, 36 Prozent gehen sogar von mehr Bestellungen aus. Lediglich 15 Prozent erwarten weniger Aufträge.
Die bis anhin aufgehellte Stimmung kommt auch in der Schweizer Exportstatistik zum Ausdruck. Das Ergebnis der wichtigen Komponente der Schweizer Wirtschaftsleistung übertraf im 3. Quartal insgesamt die Marke von 60 Milliarden Franken. Zum Vergleich: In der Coronakrise lag der tiefste Wert noch bei 50 Milliarden Franken.
Doch höhere Preise für Rohstoffe und Energie und anhaltende Lieferengpässe könnten laut dem Branchenverband die Situation verschärfen und den Aufschwung gefährden. Wegen Unterbrüchen in den Lieferketten notierten die Preise für Stahl zeitweise weit über dem langjährigen Mittel, bei Holz haben sich die Preise vervielfacht. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Baumaterialien, die auf Erdöl basieren, wie Kunststoffteile, Isolationen, Dämm- und Trennmaterial, bei denen es bereits Mitte des Jahres zu massiven Preisaufschlägen gekommen ist. Für Baufirmen stellt sich das Problem, dass höhere Preise nicht in jedem Fall auf die Bauherrschaften überwälzt werden können, ausser es bestehen entsprechende Vertragsklauseln.
Die Materialknappheit in Folge der Lieferengpässe dürfte weiterhin ein preistreibendes Element bleiben. Die Zürcher Kantonalbank geht davon aus, dass die Baupreise auch in nächster Zeit ansteigen werden. Da der Materialverbrauch lediglich 15 bis 30 Prozent der Gesamtkosten von Hochbauten ausmacht, werde die erwartete Kostensteigerung allerdings deutlich tiefer ausfallen als bei den Rohstoffen.

Quelle: Stefan Schmid
Beim Projekt Wolkenwerk haben in Zürich-Oerlikon die Bauarbeiten für den Messeturm begonnen (Bild). Er umfasst ausschliesslich Gewerbe- und Büroflächen. Die vier Türme der Überbauung bieten für 1800 Menschen Wohn- und Arbeitsräume.
Aufflammen der Inflation
Die Preissteigerungen betreffen mittlerweile auch weitere Branchen, was schliesslich in der Schweiz die Inflationsrate erhöht hat. Die Preisentwicklung in der Schweiz war in diesem Jahr bisher allerdings vergleichsweise moderat. Als Grund sehen Ökonomen das erneute Erstarken des Schweizer Frankens, was dazu geführt hat, dass Importe billiger wurden, und der Preisauftrieb dadurch teilweise kompensiert wurde. Für exportorientierte Unternehmen ist der starke Franken allerdings eine Belastung. Aufgrund der internationalen Verflechtung dürften die Preise in der Schweiz tendenziell weiter steigen, indem sie gleichsam importiert werden, was bei Unternehmen die Produktionskosten weiter erhöht.
Ein Trend nach oben gab es in der Schweiz bereits in den letzten Monaten. Seit August hat sich die Teuerungsrate erhöht und erreichte im November den Wert von 1,5 Prozent nach 1,2 Prozent im Oktober. Das ist noch deutlich weniger als in anderen Ländern. In den USA erreichte die Inflationsrate zuletzt 6,2 Prozent. In diese Richtung könnte es auch in Europa gehen, etwa in Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Die deutsche Bundesbank hält einen sprunghaften Anstieg der Inflation auf knapp sechs Prozent im November für möglich. Im Oktober betrug die Inflation in Deutschland noch 4,5 Prozent. Hohe Inflationsraten können laut dem Ifo-Institut signalisieren, dass die Preise aktuell stark steigen oder dass sie vor einem Jahr stark gesunken sind. Das wäre ein Argument für die These, dass die Inflation wegen Nachholeffekten lediglich vorübergehender Natur ist. Dieser Ansicht ist nach wie vor EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die EZB dürfe «angesichts vorübergehender oder angebotsbedingter Inflationsschocks nicht zu einer vorzeitigen Straffung der Geldpolitik übergehen», erklärte sie jüngst.
Risiken und Nebenwirkungen
Steigenden Energiepreise und Störungen in den internationalen Lieferketten erklären aber im Grunde nur einen Einmaleffekt auf das Preisniveau, nicht jedoch eine dauerhafte Erhöhung von dessen Zuwachsrate, der Inflation, wie Ernst Baltensperger, emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern, in einem Beitrag in der NZZ schreibt. Und er verweist auf Entwicklungen in der Vergangenheit. In den 70er-Jahren führte nicht allein der Ölpreisschock zu einer hohen Inflation. Diese habe ihren Ursprung im Jahrzehnt davor gehabt, als die amerikanische Notenbank zur Finanzierung staatlicher Programme und des Vietnamkriegs damit begonnen habe, die Zinsen tief zu halten. In dieser Zeit ortet Baltensperger auch den Beginn der expansiven Geldpolitik und er mahnt, dass die Zentralbanken das Inflationsrisiko weiterhin auf die leichte Schulter nehmen. Angesichts der Verschuldungssituation der Staaten hält er die Situation momentan für explosiver als damals.
Dabei besteht das Risiko, dass sich laut den ökonomischen Modellen die Inflation über Jahre auf höherem Niveau einpendelt als in den letzten Jahren. Das Entstehen einer Stagflation für einen solchen Fall wurde bereits von verschiedener Seite als Schreckensszenario skizziert. Die Ingredienzen dazu sind zum einen steigende Produktionskosten und ein anhaltender Margendruck bei den Unternehmen als Folge des Preisschocks. Höhere Preise erfassen zum anderen weitere Güter und Dienstleistungen, was die Inflationsrate zusätzlich in die Höhe treiben kann, sodass schliesslich bei steigender Arbeitslosigkeit die Wirtschaft stagniert.
Aufschwung bedroht
Eine Bedrohung für die wirtschaftliche Erholung ist momentan aber die Omikron-Variante des Coronavirus. Gemäss ersten Schätzungen von BAK Economics könnte die Mutation das Schweizer Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 mehr als halbieren. Laut dem Forschungsinstitut könnte Omikron im nächsten Jahr das Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts insgesamt auf 1,3 Prozent drücken. Aktuell und ohne Omikron gehen die Forscher von einer Zunahme im Bereich von drei Prozent aus. BIP-Prognosen anderer Institutionen werden dem Vernehmen nach in diesen Tagen revidiert.
Ganz so schlimm muss es nicht kommen. Viele Länder haben in diesem Jahr eine hohe Impfrate erreicht. Bewährt hat sich letztes Jahr die pragmatische Lösung, welche etwa die Tourismusregionen umsetzen konnten. Das liesse sich in den nächsten Monaten wiederholen, zumal in vielen Wintersportgebieten bereits genügend Schnee liegt. Das Tourismussegment war dieses Jahr bisher auf gutem Weg. Die geplante Bausumme des Segments legte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 14,2 Prozent zu, befand sich aber noch deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.
Anlass zur Sorge bereitete im vergangenen wie in diesem Jahr
der Bürobau. Homeoffice war während der Pandemie das Gebot der Stunde. Ausdruck
der Unsicherheit über den Einfluss künftiger Trends in der Arbeitswelt auf den
Büroflächenbedarf war die starke Volatilität der quartalsweise erfassten
Bausumme. Von den wichtigen Segmenten ist es das einzige, das in den letzten elf
Monaten ein Minus verzeichnete (YTD: -13,9 %).
Szenarien für den Bürobau
Hybride Arbeitsformen dürften auch auf mittel- bis
langfristige Sicht Bestand haben. Davon geht das Immobilienberatungsunternehmen
Wüest Partner aus und hat in einer Analyse den Büroflächenbedarf bis 2030
quantifiziert. Eines der Szenarien geht von einem starken Wirtschaftswachstum
und einer gleichzeitigen Flächenreduktion um zehn Prozent aus. Demnach wäre der
jährliche Büroflächenbedarf höher als in der letzten Dekade durchschnittlich
jeweils in zwölf Monaten neu gebaut wurde. Bei einem mässigen Wirtschaftswachstum
oder bei einer stärkeren Reduktion der Flächen würden dagegen weniger Büroräume
nachgefragt als heute. Als starken Treiber der Büroflächennachfrage sehen die
Immobilienexperten von Wüest Partner die Digitalisierung.
Öffentliche Hand zieht mit
Impulse setzen wird auch der Bau von Schulhäusern.
Beispielhaft zeigt sich dies in der Stadt Zürich. Prognosen gehen davon aus,
dass sich dort die Zahl schulpflichtiger Kinder bis 2028 / 29 um 15,5 Prozent
erhöhen wird. Ab 2023 / 24 werden daher die Tagesschul-Strukturen etappenweise
ausgebaut. Gesamthaft dürfte die Stadt bis 2030 rund zwei Milliarden Franken in
Grossprojekte für den Bau von Schulgebäuden investieren. Hohe Zuwachsraten bei
der Bausumme zeigte das Segment bereits in den vergangenen drei Quartalen. Die
geplanten Investitionen in Schulgebäude erreichte per Ende November sogar den
höchsten Wert der letzten Dekade.
Das Segment Gesundheitswesen und Fürsorge kam erst gegen Jahresende in die Gänge. Dem ausserordentlich hohen Investitionsvolumen im letzten Monat ist es zuzuschreiben, dass sich die Bausumme per November doch noch ins Plus drehte (+6,7 %). Die Baubranche kann insgesamt zwar mit Zuversicht auf die nächsten zwei Jahre blicken, doch haben sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verdüstert.