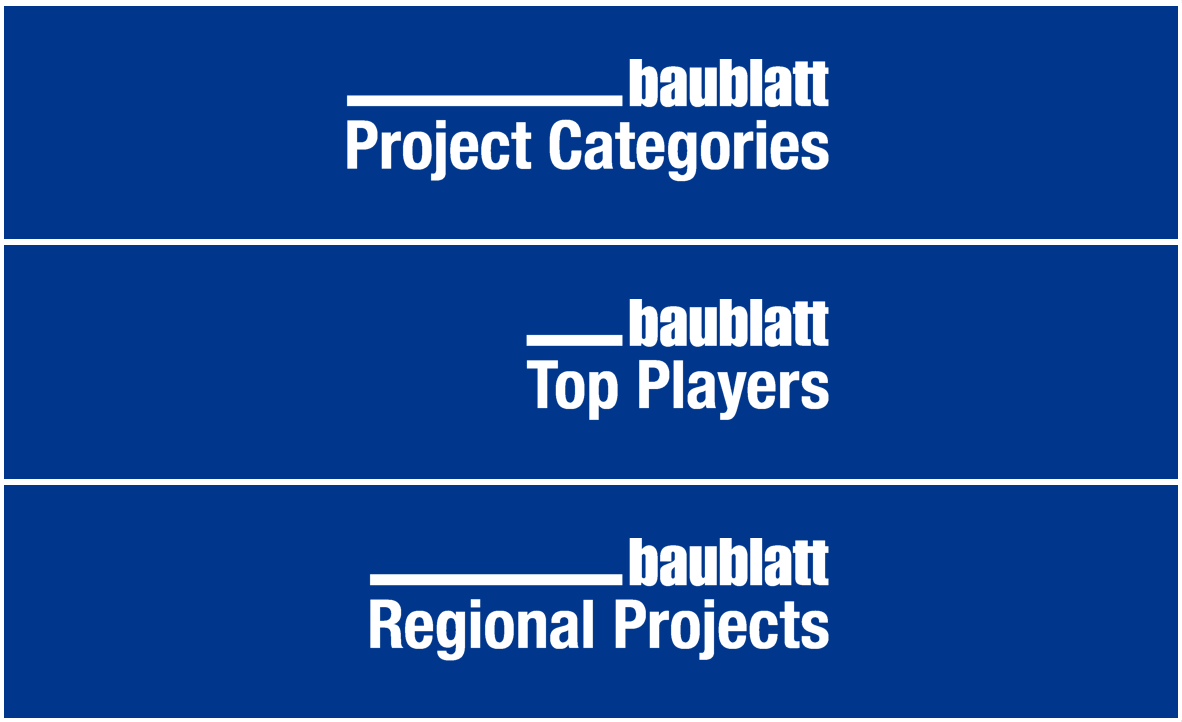Gemeinsam für mehr Pumpspeicherwerke
Die Dachverbände der Elektrizitätswirtschaft aus der Schweiz, Österreich und Deutschland haben die "Energie-Initiative der Alpenländer" gegründet. Sie wollen im Bereich der Pumpspeicherkraftwerke in Zukunft enger zusammenarbeiten, wie der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) am Donnerstag mitteilte.
Die Regierungen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz haben sich zum Ziel gesetzt, den Ausbau von Pumpspeicherkraftwerken durch eine verstärkte Zusammenarbeit voranzutreiben. Um diese Kooperation durch die jeweiligen Dachverbände energiewirtschaftlich zu flankieren, gründeten VSE, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und Österreichs Energie die "Energie- Initiative der Alpenländer".
Im Fokus der Initiative sollen vor allem faire regulatorische Rahmenbedingungen und eine verbesserte länderübergreifende Koordination des Ausbaus von Energiespeichern in der Alpenregion stehen, wie der VSE schreibt.
Der Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke bringe aus Sicht der Energieverbände hohe volkswirtschaftliche und ökologische Vorteile für die Energieversorgung in ganz Europa. Neue Projekte seien aber aufgrund der aktuellen Verzerrungen an den Strommärkten akut gefährdet, schreibt VSE.
Die Begründer der Energie-Initiative der Alpenländer rufen daher die europäischen und nationalen Institutionen und Entscheidungsträger auf, rasch Massnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Betrieb und den Neubau von Pumpspeichern umzusetzen. Sie fordern unter anderem den Verzicht auf regulatorische Eingriffe. (sda)
Eine neue Broschüre gibt Auskunft über die «Energie-Initiative der Alpenländer» und stellt die Notwendigkeiten für den Ausbau der Pumpspeicherkraftwerke vor.
Hintergrund
Aktuell sind in Europa 170 Pumpspeicherkraftwerke in Betrieb. Gemeinsam verfügen allein Deutschland, Österreich und die Schweiz mit einer Kapazität von 12.500 Megawatt über einen sehr umfangreichen Anteil an der gesamten Pumpspeicherleistung in Europa. Weitere Projekte mit einer Kapazität von 11.000 Megawatt sind in Vorbereitung oder in Bau. Die damit verfügbare Leistung würde ausreichen, um den Speicher- und Flexibilitätsbedarf der Region Deutschland- Österreich-Schweiz bis 2020 zu decken. Auch nach 2020 sind neue Pumpspeicherkraftwerke erforderlich, um die schwankende Einspeisung aus Erneuerbaren Energien, deren Anteil an der Erzeugung weiter steigen wird, sicher ausgleichen zu können und somit die Stromnetze zu stabilisieren. (mgt)