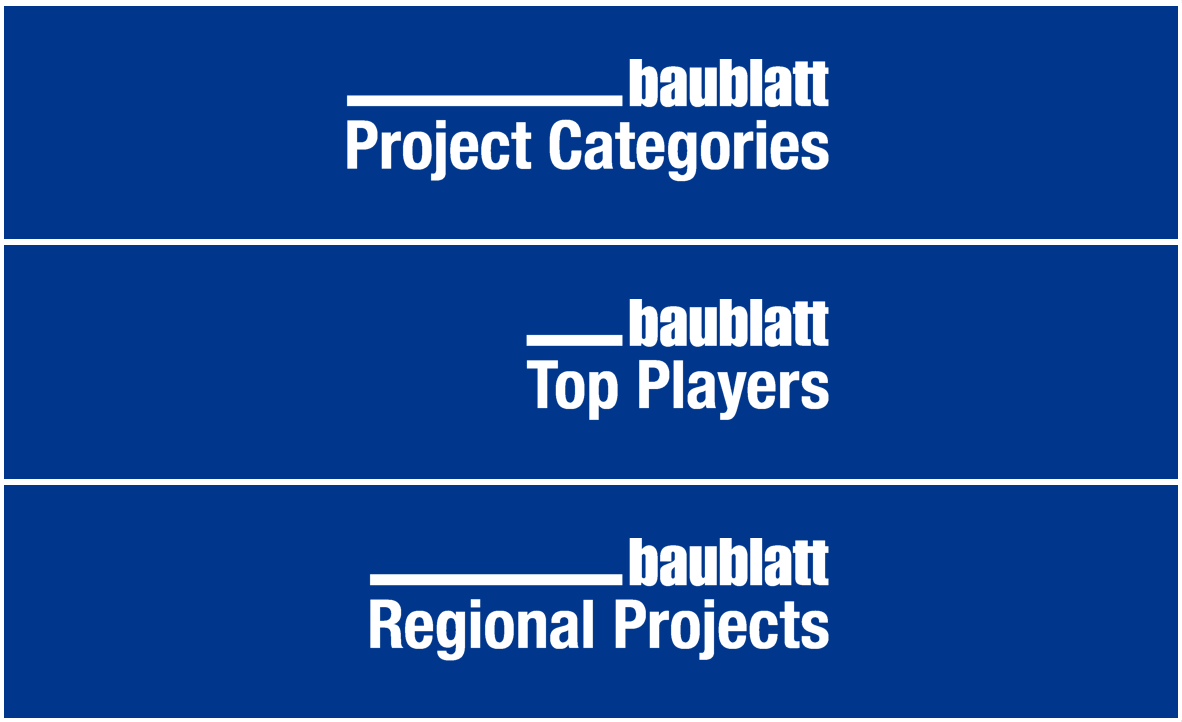Bauprozesse: «Es gibt immer etwas zu verbessern»
Im Bauprozess gilt es manche Hürde zu überwinden. Welche dies sind, weiss Bauingenieur Dominik Schlatter aus seiner Praxis. Im Gespräch berichtet er, wie schlanke Prozesse und frühzeitige, detaillierte Planung helfen, trotz komplexem Umfeld günstiger zu bauen.

Quelle: zvg
«Das Zusammenspiel zwischen Bauherr, Planer und Unternehmer muss funktionieren. Dafür braucht es gut ausgebildete Leute mit Erfahrung», sagt Dominik Schlatter, «Lean Construction»-Experte und selbstständiger Berater.
Sie beraten sowohl Unternehmer als auch Bauherren im Bauprozess. Wann werden Sie als Experte beigezogen?
Dominik Schlatter:Eigentlich von der Ausschreibung bis hin zur Abrechnung. Gerade öffentliche Grossbauprojekte sind hart umkämpft, die Kalkulationen entsprechend ausgeklügelt und komplex. Das hat sicher mit dem umfangreichen Normpositionenkatalog zu tun, der zwar die Vergleichbarkeit von Offerten erhöht, diese aber nicht einfacher macht. In der Praxis weisen zudem Ausschreibungen immer wieder erstaunliche Lücken auf. Die entsprechenden Versäumnisse holen den Bauherren spätestens dann ein, wenn die Unternehmer Zusatzleistungen nachfordern. Klar, der Projektleiter auf der Bauherrenseite kann die Ausschreibung nicht abschliessend beurteilen, dafür fehlt ihm schlicht das detaillierte Baufachwissen. Es braucht also Vertrauen – nur hat man nicht immer gute Partner. Ich vertrete heute Bauunternehmen im Nachtragsmanagement, aber auch Bauherren, die mit entsprechenden Forderungen konfrontiert sind. Beides findet nicht im luftleeren Raum statt. Matchentscheidend ist es, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu machen, gerade hinsichtlich späterer juristischer Auseinandersetzungen.
Wie wirken sich solche Streitigkeiten auf den Bauprozess aus?
Die Abwicklung eines Projekts, bei dem man mit dem Unternehmer permanent im Konflikt steht, kann nicht mehr schlank sein. Aus dem bautechnischen Streit auf der Baustelle wird eine finanzielle Forderung, die entweder beglichen oder vor Gericht bestritten wird. In einem solchen Konflikt verlieren beide Parteien wohl oder übel viel Zeit und Geld. Es macht also Sinn, zu Projektbeginn mehr zu planen, so wie dies beispielsweise bei der Anwendung des Building Information Modelings – oder kurz BIM – geschieht. Professionelle Bauherren sind aus gutem Grund von einer rollenden Planung abgekommen. Sie haben eingesehen, dass es unsinnig ist, zuerst die Unternehmer zu engagieren, draufloszubauen und dann ein grosses Änderungs- und Nachtragsmanagement aufzuziehen. Die geltende SIA-Honorarordnung unterscheidet aber immer noch zwischen «Ausschreibungsplänen» und «Ausführungsplänen». Das Delta dazwischen sind die Nachforderungen der Unternehmer. Das ruiniert nicht nur die Projektrendite, sondern führt vor allem auch dazu, dass in der Schweiz schlicht und einfach zu teuer gebaut wird. Das wird uns einholen, davon bin ich überzeugt. Denn in den letzten Jahren sind auch die Landpreise gestiegen. Wenn sich in der Folge der Mittelstand kein Wohneigentum mehr leisten kann, wird die entsprechende Nachfrage einbrechen – mit ungemütlichen Folgen für die Baubranche.
Günstiger zu bauen, dürfte hierzulande aber schwierig sein. Wie können wir es dennoch schaffen?
Wir müssen uns einerseits überlegen, für welche Lebensdauer wir bauen. Grosse Detailhandelsketten in der Schweiz tun dies heute beispielsweise nur noch für einen Zeithorizont von zehn Jahren, da sich das Marktumfeld wegen des boomenden Onlineshoppings kräftig wandelt. Dann muss allenfalls eine kostengünstige Schliessung möglich sein. Andererseits helfen hier sicher Ansätze wie «Lean Construction». Es gibt immer etwas zu verbessern – auf allen Ebenen und in allen Prozessen. Wenn beispielsweise die 160 Nasszellen für ein neues Hotel fixfertig ausgebaut angeliefert werden, sind diese vor Ort nur noch ans Strom-, Wasser- und Abwassernetz anzuschliessen – fertig. Solche schlanken Prozesse brauchen wir. Um diese etablieren zu können, müssen wir mehr vorfertigen. Es ist viel effizienter, in einer trockenen Halle zu produzieren statt auf der Baustelle bei Wind und Wetter. Unter solch kontrollierten Bedingungen kann stets die gleiche Qualität abgeliefert werden. Und die Vorfertigung setzt auch einigen unsinnigen Schnittstellen ein Ende. Im Holzmodulbau montiert heute beispielsweise der Zimmermann auch gleich die Elektroanschlüsse, der Elektroinstallateur muss dafür nicht mehr eigens vorbeikommen. Im Bauwesen gibt es weitere festgefahrene Arbeitsweisen, die dringend zu überdenken wären, da sie die Kosten des Bauherrn ohne jeden Mehrwert erhöhen. Nur wenn wir alte Zöpfe abschneiden, werden die Bauten günstiger.
Optimierungspotenzial gibt es sicher auch beim Flächenmanagement auf der Baustelle.
Auf jeden Fall. Früher unterlag die Bauplatzinstallation einer statischen Betrachtung. Bei immer engeren Platzbedingungen – etwa im städtischen Umfeld – ist der Unternehmer heute jedoch gezwungen, dynamisch zu planen. Wo in der Nähe des Neubaus soll er beispielsweise die vorfabrizierten Stützen lagern, um diese dann effizient versetzen zu können? Oder wie erreicht er eine Just-in-time-Anlieferung, die sein Zwischenlager verkleinert? Eine zeitgemässe Baustellenplanung umfasst also plötzlich ganz neue Aufgabenfelder.
Wie wichtig ist bei einem Bauprojekt die Planung der Planung?
Wichtig ist vor allem, in einer frühen Phase detaillierter zu planen – unabhängig davon, ob dies drei- oder zweidimensional geschieht. Für ein Einfamilienhaus brauchen wir heute keine 3D-Planung. Dort benötigt der Bauherr einen fähigen Projektleiter, der mit allen Projektbeteiligten gut zusammenarbeitet. Konfliktfrei zu planen ist auch in 2D möglich. Sollen die Planungsdaten und Bauteilspezifikationen von komplexen Bauten während des gesamten Immobilienzyklus bis hin zum Facilitymanagement genutzt werden, bietet BIM unbestrittenermassen einen Mehrwert. Aber diesbezüglich sind wir in der Schweiz erst ganz am Anfang.
Welche Rolle sollte BIM generell spielen?
BIM ist für mich primär eine Methode zur Bauplanung. Dass man heute etwa versucht, ohne Papierpläne auf der Baustelle zu arbeiten, hat meiner Meinung nach mit dem BIM-Grundsatz nur am Rande zu tun. Das Entscheidende für den Unternehmer sind doch die Attribute, die bei den einzelnen BIM-Bauteilen hinterlegt sind. Diese ermöglichen eine automatisierte Mengenermittlung und eine saubere Offerte. Klar erlaubt BIM zudem, die Teilmodelle der einzelnen Gewerke dank der IFC-Schnittstelle zusammenzuführen und Kollisionen automatisiert zu erkennen. Doch diese Aufgabe, die heute «Clash Detection» genannt wird, war schon immer Sache des Projektmanagements. Eigentlich geht es unverändert darum, mögliche Konflikte in der Planungsphase frühzeitig zu erkennen, miteinander zu besprechen und unnötige Folgekosten mittels cleverer Entscheide zu verhindern. Diese fällt jedoch keine Software. Hier braucht es einen guten BIM-Koordinator, der dem Bauherren bei planerischen Konflikten mögliche Lösungen und deren Konsequenzen aufzeigt. Das Zusammenspiel zwischen Bauherr, Planer und Unternehmer muss also funktionieren. Und dafür braucht es gut ausgebildete Leute mit Erfahrung. Sicher sollte ein BIM-Koordinator programmieren und Schnittstellen einlesen können, zentral ist jedoch seine Kompetenz, bei Kollisionen die richtigen Lösungen vorzuschlagen.

Quelle: Gabriel Diezi
Bei Bauarbeiten im städtischen Umfeld sind schlanke Prozesse aufgrund der engen Platzverhältnisse besonders wichtig (Bild: Zürcher Europaallee im Frühling 2017).
Wird das nicht zunehmend schwieriger?
Die Komplexität der Bauprojekte hat sicher zugenommen. Beispielsweise bietet die Haustechnik heute deutlich mehr Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahren, weshalb ihre Planung aufwendiger geworden ist. Der Beizug eines Fachplaners wird so zur Pflicht. Zudem hat die Anzahl der Vorschriften und Normen zugenommen. Beim behindertengerechten Bauen sind die Anforderungen beispielsweise gewaltig. Bei einer Fülle von mehr als 250 SIA-Normen ist es als Architekt schwierig, noch den Durchblick zu haben. Ich habe in der Praxis auch Fälle gesehen, wo der öffentliche Bauherr dem günstigsten Unternehmer den Zuschlag gab und von diesem erst nach der Vertragsunterzeichnung darauf hingewiesen wurde, dass die Planung zwingende Normen verletze und so nicht umgesetzt werden könne. Dann kommt das böse Erwachen mit grossen Umplanungen, etwa bezüglich des Gefälles bei Spenglerarbeiten oder der Robustheit von Geländern, für die im öffentlichen Bereich strengere Regeln gelten als im privaten.
Das Bauumfeld ist also generell anspruchsvoller geworden?
Tatsächlich gewinnen komplexe Umbauten im Bestand an Bedeutung, während Neubauten auf der grünen Wiese seltener werden. Beim Hochbau sind heute etwa Sanierungen und Ersatzneubauten im urbanen Umfeld die Herausforderung. Anspruchsvolle Ausführungsvoraussetzungen sind definitiv weit verbreitet. Das gilt auch für den Tiefbau, der nur noch selten neue Einfamilienhausquartiere zu erschliessen hat. Stattdessen sind stark befahrene Autobahnen mehr und mehr unter laufendem Betrieb auszubauen, da dies das Gesetz im Einklang mit unserer Gesellschaft so verlangt. Öffentliche Bauherren wie das Astra schaffen zudem bereits bei der Ausschreibung finanzielle Anreize, um die Bauzeit zu reduzieren. Bei der Sanierung der A1 müssen heute etwa die Unternehmer die benutzte Arbeitsfläche mieten. Bei vorzeitiger Fertigstellung der Arbeiten resultiert – bei gleichbleibendem Ertrag – ein entsprechend geringerer Aufwand für Platzmieten. Unter diesen Rahmenbedingungen haben beispielsweise Verzögerungen bei der Planauslieferung sofortige finanzielle Konsequenzen. Die effiziente Führung einer Baustelle entscheidet also direkt über Gewinn und Verlust.
Wie können bei öffentlichen Ausschreibungen trotz des dominanten Preises die qualitativen Faktoren stärker gewichtet werden?
Als einziges klar messbar ist und bleibtder Preis. Die anderen Kriterien heissen nicht umsonst weiche Faktoren. Und beim Einladungsverfahren werden diese gar zur Makulatur: Sie werden in der Submission niemanden anfragen, von dem sie denken, dass er sein Handwerk nicht beherrscht. Das wäre ja ein Widerspruch in sich. Aufgrund der schwachen Rechtsmittel, die zudem hinsichtlich weiterer Ausschreibungen nur wenige Unternehmer ergreifen werden, können Bauherren hier anders vergeben. Und bei grossen WTO-Submissionen werden alle teilnehmenden Unternehmen die notwendigen Referenzen beibringen können und auch die sonstigen qualitativen Anforderungen erfüllen. Bei den weichen Faktoren gibt es folglich eine Nivellierung, die auch Einsprachen mit aufschiebender Wirkung verhindern soll. Somit kommt es letztlich wieder auf den Preis an.
Gibt es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis?
Gewisse Kantone wie etwa der Thurgau führen eine «ständige Liste» über qualifizierte Anbieterinnen und Anbieter des Bauhaupt- und Baunebengewerbes. Für die Aufnahme darauf können sich Unternehmer jährlich bewerben, und erhalten bei Erfolg das kantonale «Gütesiegel», dass sie bezüglich der qualitativen Faktoren überzeugen. Ähnlich funktioniert ein zweistufiges Verfahren, dessen Verfechter ich bin. In der ersten Stufe wird die qualitative Spreu vom Weizen getrennt, erst in der zweiten geht es primär um den Preis. Solche Submissionen sind ehrlicher und mit viel weniger Einsprachen seitens der Unternehmer verbunden.
Zur Qualitätssteigerung in der Branche tragen auch Sie als Ausbildner von Baufachleuten bei.
Ja, aber an Schulen können wir primär eine solide fachliche Basis vermitteln. Bei der Planung und der anschliessenden Ausschreibung geht es aber nicht nur um die Frage, was man bauen will, sondern auch wie. Dieses «Wie» wird oft vernachlässigt und beschäftigt dann später die Gerichte bei Konflikten zwischen Bauherren und Unternehmern. Der Entscheid über das «Wie» ist zudem viel komplexer als derjenige über das «Was», und verlangt entsprechend viel Erfahrung. Diese kann sich der Kadernachwuchs nur auf der Baustelle holen.
Gibt es denn in der Praxis Unternehmen, die trotz intensivem Preis- und Zeitdruck junge Leute gezielt fördern?
Ja klar, die einen Unternehmen machen dies konsequent. Sie investieren viel Zeit und Geld in die Ausbildung ihrer jungen Baukader. Die anderen werfen sie ins kalte Wasser, dies jedoch meistens zu ihrem eigenen Schaden. Ich sage jeweils: Das Lehrgeld das ein Junger bezahlt, ist zum Glück nicht sein eigenes, sondern dasjenige seines Chefs.
Und wie kommen alte Bauhasen beruflich weiter?
Indem sie sich regelmässig up to date bringen, Kurse und Weiterbildungen besuchen und so mit der Flut neuer und angepasster Normen Schritt halten. Allein dafür benötigt man in einer Unternehmung viele Ressourcen. Zudem gilt es, die Scheuklappen abzulegen und gängige Praktiken immer wieder zu hinterfragen.
Zur Person

Quelle: zvg
Bauingenieur und Consultant Dominik Schlatter
Dominik Schlatterist Inhaber der Schaffhauser «LeanCONSag». Der Bauingenieur FH mit betriebswirtschaftlichem Nachdiplomstudium ist spezialisiert auf prozessuale Beratungen von der Bauausschreibung bis zur -abrechnung. Er vertritt Unternehmer im Nachtragsmanagement, aber auch Bauherren, die mit diesem konfrontiert sind. Der ehemalige Baukadermann und ausgebildete Maurer verfügt über fundierte Führungs- und Praxiserfahrung auf Unternehmensseite. Schlatter ist zudem langjähriger Dozent an der Baupolierschule der Baugewerblichen Berufsschule Zürich, an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur sowie am Forum Bau und Wissen in Wildegg.(gd)